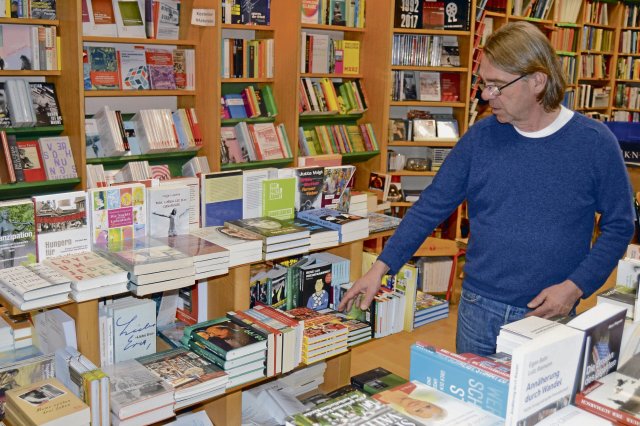Auch ohne Not ins Krankenhaus
Ein albanischer Flüchtling klagte über starke Kopfschmerzen. Über eine Sprachmittlerin im Flüchtlingsheim, in dem er wohnte, beschrieb er die Schmerzen. Eine Mitarbeiterin schrieb mit und gab ihm die Niederschrift für einen Arzt mit. Einen Sprachmittler, der ihn zum Arzt begleitet, bezahlt weder das Heim, noch das Land Berlin noch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Am Abend kam der Mann enttäuscht zurück ins Heim. Dabei hatte er einen Brief vom Arzt. »Sprachliche Kommunikation ist die Grundlage jedes Arzt-Patient-Verhältnisses. Ohne die kann ich den Mann nicht behandeln«, stand dort. Was nun? Die Rettung war die Notaufnahme im benachbarten Krankenhaus. Dort findet sich häufig muttersprachliches Personal. Hier erhielt der Mann endlich Hilfe.
Den Krankenhäusern passt es allerdings nicht, dass Menschen zu ihnen kommen, deren Erkrankungen weder bedrohlich sind noch akut behandelt werden müssen. Denn dann müssen die echten Notfälle warten. Ein weiterer Grund sind die Kosten: 32 Euro erhält eine Rettungsstelle für die ambulante Versorgung eines Patienten, weniger als ein niedergelassener Arzt. Die wahren Kosten liegen bei vielen ambulanten Behandlungen deutlich höher, durchschnittlich geht man von 120 Euro aus. 25 Millionen Patienten bundesweit nehmen jährlich Notaufnahmestellen in Anspruch. Viele von ihnen kommen mit harmlosen Halsschmerzen.
Für Flüchtlinge ist das Krankenhaus oft die einzige Möglichkeit, behandelt zu werden. Nicht immer ist die Sprachhürde das Problem. Auch in Arztpraxen steigen die Patientenzahlen: von 2006 bis 2016 um 35 Prozent. Viele Ärzte sind überlastet und nehmen keine neuen Patienten auf. Das sind Flüchtlinge fast immer.
Doch nicht nur Flüchtlinge sind es, die mit leichteren Erkrankungen Notaufnahmen aufsuchen, sagt der LINKE-Gesundheitspolitiker Wolfgang Albers. »Ein Patient weiß vor dem Arztbesuch oft nicht, wie gefährlich die Krankheit ist.« Hinzu käme, dass am Wochenende kaum Arztpraxen geöffnet seien. Viele Patienten gingen zudem lieber nach Feierabend zum Arzt, doch auch dann seien die meisten Praxen geschlossen. »Ein Umerziehen der Patienten zu den bestehenden Strukturen ist aussichtslos«, sagt Gesundheitssenatorin Dilek Kolat (SPD). »Vielmehr müssen sich die Strukturen den geänderten Realitäten anpassen.« In diese Kerbe haut auch Wolfgang Albers. »Patientenschelte hilft hier nicht weiter. Die Gesundheitspolitik muss sich hier ehrlich machen und auch Krankenhäusern die ambulante Versorgung bedarfsdeckend ermöglichen.« Wer in den Nächten und am Wochenende Patienten behandelt, müsse dafür adäquat vergütet werden. »Zu den Sätzen, die die Kassenärztliche Vereinigung abrechnet«, so Albers. Und dann eben zu deren Lasten.
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.