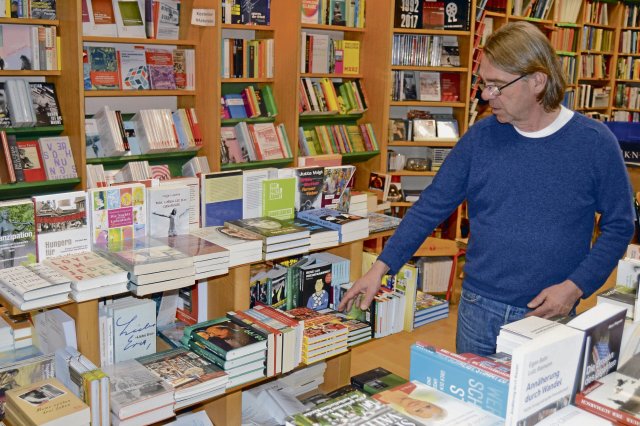- Berlin
- Nachhaltigkeit
Industrie in Berlin: Schöne neue Welt?
Wirtschaftsausschuss sieht Chancen für nachhaltige Produktion in Berlin
Industrielle 3-D-Drucker fertigen in Berliner Hinterhöfen unablässig Einzelstücke nach Kundenwunsch, Lkw laden ihre Fracht vor den Toren der Stadt auf Zugmaschinen mit Elektromotoren um, auf den Dächern der Stadt erzeugen kleine Windräder Energie, Sonnenlicht wird in fensterlose Räume neuer Etagenfabriken geleitet: Am Montag zeichneten Lobbyisten, Fachleute und Abgeordnete aus einem Potpourri von Science-Fiction, Innovation und Appellen Visionen einer leuchtenden Zukunft. Auf Antrag der regierenden Fraktionen wurde sich im Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Betriebe zum Thema nachhaltige, urbane Industrieproduktion in Berlin besprochen. Zu Grunde lag dabei die Frage, wie die Metropolregion, in der bereits zwei Drittel der DAX-Konzerne vertreten seien, ihren Export von Produkten steigern könne.
Derzeit werde vor allem Know-how aus Berlin ausgeführt - gar von einem möglichen »Brain-Drain« war die Rede, ein Wort, das sonst häufig im Zusammenhang mit der Abwanderung von Fachkräften und Intellektuellen aus Bürgerkriegsländern verwendet wird. So erklärte Klaus Abel, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Berlin: »Wir haben tatsächlich im Moment einen Länderfinanzausgleich in der Form, dass in Berlin Menschen an den Universitäten ausgebildet werden und dann nach Süddeutschland gehen, wo sie dann in den Kernbereichen der Industrie tätig sind.« Hier solle man gegensteuern.
Denkbare Maßnahmen werden seit Anfang September im Zuge des vom Senat beschlossenen »Masterplans Industriestadt Berlin 2018-2021« erarbeitet. Dabei gehe es darum, »Berlins Profil als digitale Werkbank weiter zu schärfen«. So verzeichne die Hauptstadt in den letzten Jahren ein überdurchschnittliches Wirtschaftswachstum und habe sich »durch seine exzellente Forschungslandschaft, seine starke Digital- und Kreativwirtschaft und zahlreiche innovative Start-ups als attraktiver Wirtschafts- und Industriestandort etabliert.« Beim angestrebten weiteren Ausbau dieser Entwicklung gehe es Rot-Rot-Grün jedoch auch um Ökologie und Nachhaltigkeit. »Industriepolitik ist nicht nur Wirtschaftspolitik«, erklärte auch Sven Weickert vom Unternehmensverband Berlin und Brandenburg (UVB). Es gehe gerade auch um bezahlbare Immobilien für Konzerne, »engste Zusammenarbeit zwischen Universitäten und Industrie« und das Vorantreiben der Digitalisierung. Mit Blick auf das von der Stadtgesellschaft gerne zur Erholung genutzte Flugfeld meinte er zudem: »Tempelhof darf auch nicht auf ewig ein weißer Fleck bleiben.«
Konkret geplante oder beschlossene Projekte listete am Montag besonders Senatorin Ramona Pop (Grüne) auf - etwa den rund 600 Millionen Euro schweren Siemens-Campus, der mit dem Campus Charlottenburg und der industriellen Nachnutzung des Tegeler Flughafenareals im Nordwesten der Stadt produktiv wechselwirken soll. Für letzteres sieht ein weiterer »Masterplan« gar die Errichtung einer »Urban Tech Republic« vor. Im Bereich »Grüne Chemie«, einem »Feld mit riesigem Potenzial«, betonte Markus Krause von der Industrie- und Handelskammer zudem die Bedeutung der voraussichtlich 2021 an der Technischen Universität eingerichteten Chemical Invention Factory.
Wie weit die in regelrechten Schlagwortschlachten gezeichneten und mit allerlei Anglizismen und Abkürzungen verzierten Visionen am Ende tatsächlich tragen werden, ist indes unklar. Während IG Metall-Mann Abel hier »eine echte Chance in puncto Industriearbeitsplätze« sieht, äußerten sich die übrigen Fachleute zurückhaltend. So erklärte Ulrich Misgeld vom Unternehmensnetzwerk Motzener Straße etwa: »Ich glaube auch nicht, dass es große Industrieansiedlungen in Berlin geben wird.« Er betonte stattdessen die Rolle kleiner und mittelständischer Unternehmen. »Wir müssen uns darauf einstellen, dass wir in Größenordnungen keine industrielle Produktion mehr hier herbekommen«, erklärte auch UVB-Vertreter Weickert. Zu bedenken ist auch, dass Berlin bereits seit 2010 am damals noch »Masterplan Industriestadt Berlin 2010-2020« genannten Vorhaben laboriert. Damals entfielen in der Hauptstadt lediglich 30 Arbeitsplätze in der Industrie auf 1000 Bewohner.
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.