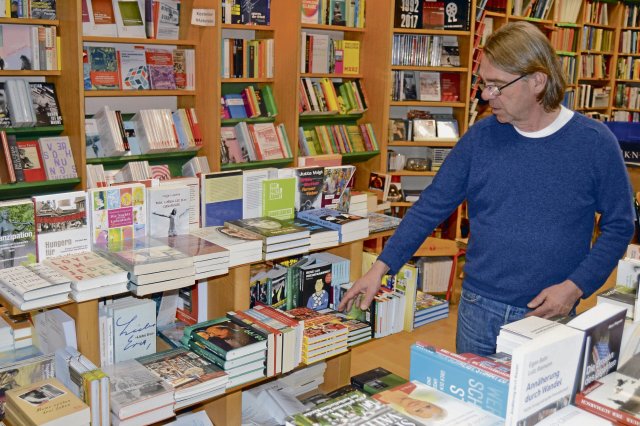- Berlin
- Therapeutenstreik
Gesteigertes Selbstbewusstsein
Die Streiks der Beschäftigten der Charité-Tochter CPPZ könnten in die Verlängerung gehen
Für die meisten Kolleg*innen war es der erste Streik ihres Lebens. Die ungleiche Bezahlung und die Abwertung therapeutischer Berufe wie Physio- und Ergotherapeut*in oder Masseur*in durch Billiglöhne bei der Charité-Tochter CPPZ hat seit Jahren für Wut gesorgt. Doch ohne das Engagement eines festen Kerns von Aktiven wäre der Streik nicht möglich gewesen. Gerade in einem Betrieb mit vielen befristeten Arbeitsverträgen und einem niedrigen gewerkschaftlichen Organisationsgrad ist es nicht einfach, zu solch einem selbstbewussten gemeinsamen Auftreten von streikenden Beschäftigten zu kommen, wie man es in diesem Arbeitskampf erleben kann.
»Es gab viele Gespräche in den Mittagspausen mit dem Ziel, den Unerfahrenen diesen Weg aufzuzeigen, klarzumachen, dass uns niemand etwas schenkt. Dass wir uns die Dinge, die uns zustehen, selbst holen müssen«, erzählt Susanne Mohrig, die vor einigen Jahren bereits einen Betriebsrat mit aufgebaut hatte.
Der Schritt der Charité, die therapeutischen Berufe in eine Tochterfirma auszugründen, bedeutete, dass die Tarife ausgehebelt wurden. Marko Große, Betriebsratsmitglied, beschreibt die Folgen: »Das führte zu hoher Fluktuation im Betrieb, Mangel an Wertschätzung, niedriger Entlohnung. Es gab drei Entgeltsystematiken in der CPPZ: Tarifzahlung der ›Gestellten‹ - also derjenigen, die noch den alten Tarifvertrag aus der Charité haben - , Tarifzahlung der Leasingkräfte und frei verhandelbare Entlohnung der neuen Angestellten. Viele Stellen wurden nicht besetzt, was heißt, dass die Arbeit auf wenige Schultern verteilt wurde, und Mehrarbeit am Wochenende bedeutet.« Mohrig fügt hinzu: »Jede*r neu Eingestellte bekam unglaublich viel weniger - etwa 800 Euro brutto im Monat.«
Dass dies systembedingt ist und viele betrifft, erklärt Josy Seeger, aktives ver.di-Mitglied an der CPPZ, sehr plastisch: »Hartz 4, Agenda 2010 - die Wirtschaft profitierte und drehte frei am Rad. Die Folgen wie Nachwuchsmangel, unbesetzte Stellen, Arbeitsverdichtung, wachsender Krankenstand müssen die Beschäftigten ausbaden. Später winkt Altersarmut.«
Mit dem Streik haben die Kolleg*innen gelernt, dass sie nicht mehr ohnmächtig sind. »Es entsteht viel Gutes unter den Streikenden. Das Selbstbewusstsein steigt sichtbar. Streik bedeutet auch politische Arbeit; es wird diskutiert und über den Tellerrand geschaut. Es ist wichtig zu kapieren, dass wir nur ein Teil des Ganzen sind«, so Mohrigs Bilanz der ersten beiden Runden des Arbeitskampfes.
Wichtig sei die Solidarität aus anderen Betrieben, sowie der Kolleg*innen in anderen Berufsgruppen an der Charité, sagt Seeger: »Auf meiner Station gibt es viel Solidarität von den Ärzt*innen, Pflegenden, Patienten und deren Angehörigen. Ich erfahre viel positives Feedback. Das ist wichtig, um durchzuhalten.« Susanne Mohrig findet wichtig, »dass man sich und den anderen immer wieder klarmacht, dass wir zwar unterschiedliche Berufsgruppen sind, aber dass die eine ohne die andere nicht arbeiten kann«. Werde der OP-Saal nicht geputzt, könne nicht operiert werden. Funktioniere der Bettentransport nicht, gelangten die Patient*innen nicht zu den Untersuchungen. »Wir sind ein großes Team und sitzen in einem Boot«, so Mohrig.
Längst haben die Streikenden die tiefer liegenden Ursachen erkannt. Josy Seeger bringt es auf den Punkt: »Das System hinter dem Gesundheitswesen ist furchtbar. Es will den marktgerechten Patienten, aber den gibt es nicht«. Der Sinn der Gesundheitsberufe sei mittlerweile »völlig entleert«. Das Wohl des Patient*innen stehe nicht mehr im Vordergrund; dort stehe jetzt die Frage nach dem Gewinn. »Und das Personal ist ausgedünnt und erschöpft. Das System ist krank, und wir, die darin arbeiten, werden es auch«, sagt Seeger.
»Wir wollen Bezahlung nach TVÖD und gleichen Lohn für gleiche Arbeit«, bekräftigt Marko Große die Forderungen der Beschäftigten.
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.