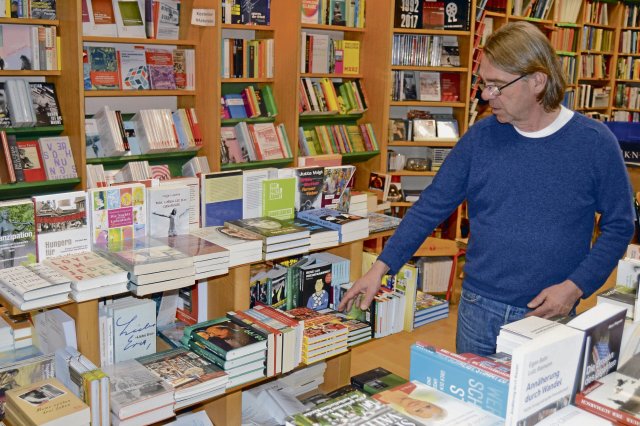- Berlin
- Berlin
Neue Siemensstadt nimmt Form an
Städtebaulicher Wettbewerb entschieden - Konzern will ab 2022 bauen
Ausgerechnet das geplante Hochhaus ist abgefallen, als das städtebauliche Modell nach der Präsentation eines Videos aufrecht auf die Bühne fährt. Dabei ist klar, dass gerade dieses Gebäude den Mittelpunkt der Siemensstadt 2.0 bilden soll. Wo derzeit noch zum Teil mäßig ausgelastete Produktionshallen von Siemens, mit einem Zaun abgeschirmt von der Umgebung, stehen, sollen ab 2022 die Bagger rollen. Das bekräftigt Vorstandsmitglied Cedrik Neike am späten Mittwochnachmittag bei der Vorstellung des Siegerentwurfs des städtebaulichen Wettbewerbs. Das Berliner Büro Ortner & Ortner Baukunst hat sich gegen 16 andere Entwürfe durchgesetzt.
Auf 70 Hektar an der Nonnendammallee, das entspricht rund 100 Fußballfeldern, sollen etwa 2750 Wohnungen entstehen. Außerdem sind Büro- und Gewerbeflächen, die Ansiedlung von Forschungs-, Entwicklungs- und Ausbildungseinrichtungen, Einzelhandelsflächen und soziale Infrastruktur vorgesehen. »Wir wollen die Zukunft der Arbeit neu definieren und einen lebenswerten Stadtteil für die Berliner schaffen«, erklärt Neike. »Festhalten wollen wir auch an der Bedeutung der Produktion«, verspricht er. Mit derzeit 11 500 Beschäftigten ist Siemensstadt immer noch der größte Produktionsstandort des Konzerns.
»Das Besondere ist, dass ein ehemals geschlossenes Konzept, ein Industriestandort, der gar nicht einladen wollte, sich zur Stadt öffnet. Das bereichert die ganze Stadt«, sagt der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD). Die Siemensstadt sei - neben der Nachnutzung des Flughafens Tegel als Wohn-, Forschungs-, und Industriestandort »Urban Tech Republic« und dem östlichen bis südöstlichen Stadtgebiet vom CleanTechPark in Marzahn über Neukölln bis zum Flughafen Schönefeld - einer der drei herausragenden Zukunftsorte, so Müller.
Zwei Tage hatte die paritätisch mit Vertretern von Senat und Bezirk sowie von Siemens besetzte Jury die 17 Entwürfe diskutiert und letztlich einmütig für das Konzept von Ortner & Ortner gestimmt. Aus Koalitionskreisen ist zu hören, dass Siemens eigentlich die Mehrheit in der Jury stellen wollte. »Es waren keine Tage, wo man es sich einfach machte«, sagt Müller. »Am Schluss ging es um zwei Entwürfe, da war das Preisgericht ziemlich sauber in der Mitte gespalten«, erklärt der Juryvorsitzende, Architekt Stefan Behnisch. Konkurrent war der Vorschlag des bekannten Architekturbüros Kleihues und Kleihues, nach dem das Areal mit recht einheitlichen Blöcken bebaut werden sollte. »Dieser Entwurf hat nicht wegen des Hochhauses, sondern trotz des Hochhauses gewonnen«, verrät Behnisch noch.
Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (LINKE) versetzt der Siegerentwurf regelrecht in Euphorie. »Der Entwurf geht mit dem Kern der Siemensstadt sehr sensibel um«, erklärt sie. Der historische und denkmalgeschützte Gebäudebestand werde respektiert, und mit dem Hochhaus werde auch das Zentrum markiert. Sie lobt die »sehr robuste städtebauliche Struktur«. »Die Siemensstadt ist Teil eines Aufbruchs im Nordwesten«, sagt die Senatorin und nennt Bauprojekte in Gartenfeld, Haselhorst und die Umnutzung des Flughafens Tegel.
Das Land Berlin hat sich verpflichtet, für eine Wiederinbetriebnahme der Siemensbahn zu sorgen. Für den Wiederaufbau der Strecke und eine Verlängerung bis ans andere Havelufer in Haselhorst kursieren bereits Kostenschätzungen von einer halben Milliarde Euro. Vor dem Abschluss der Absichtserklärung mit Siemens für die Entwicklung des Areals hegte der Senat am Mehrwert für Berlin Zweifel. Die bisherigen Pläne könnten »eher darauf schließen lassen, dass es sich bei dem Campus vornehmlich um ein Immobilienprojekt handelt«, zitiert die »Welt am Sonntag« aus Senatskorrespondenz vom September 2018. Denn der Bodenwert wird sich mit der neuen Nutzung vervielfachen.
»Das Land Berlin und die Bevölkerung in den angrenzenden Gebieten müssen eine ordentliche Gegenleistung für die Bodenwertsteigerung erhalten«, fordert Katalin Gennburg, stadtentwicklungspolitische Sprecherin der Linksfraktion im Abgeordnetenhaus. Ihr wäre es lieber, wenn die Hälfte der entstehenden Wohnungen preisgebunden wäre statt wie vereinbart 30 Prozent. »Außerdem ist ein Milieuschutz für die Umgebung überfällig. Der Bezirk Spandau muss liefern«, sagt Gennburg. Ansonsten drohe Verdrängung. Sie fordert ein kommunales Vorkaufsrecht für die Flächen, damit das Land bei Verkäufen den Zugriff hat und nicht Renditejäger.
»Ich sehe stadtentwicklungspolitisch mehr Chancen als Risiken bei dem Vorhaben«, sagt Senatorin Lompscher.
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.