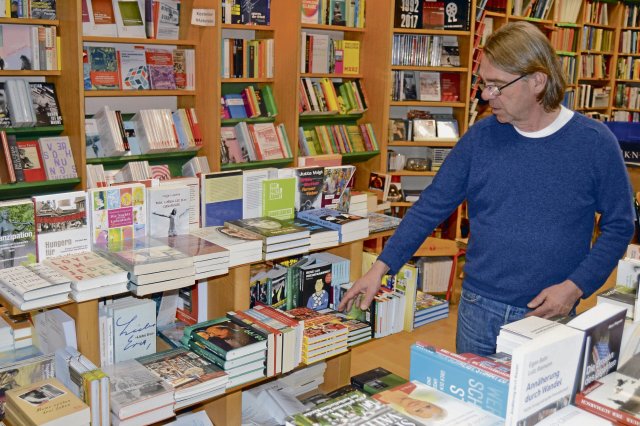- Berlin
- Landesantidiskriminierungsgesetz
Ein scharfes Schwert gegen Diskriminierung
Verbände wollen das Landesgesetz gegen Ungleichbehandlung bekannter und anwendbarer machen
Sehr viele Menschen bedanken sich, erklärt Doris Liebscher. Die Juristin leitet seit dem 1. September die Ombudsstelle der Landesstelle für Gleichbehandlung gegen Diskriminierung, die bei der Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung angesiedelt ist und bei der Umsetzung des Landesantidiskriminierungsgesetzes (LADG) eine entscheidende Rolle spielt.
Dass es damit eine staatliche Stelle gegen Behördenwillkür gibt, eine Stelle, die nicht abwiegelt, sondern sich genau dafür interessiert, können sich viele noch nicht recht vorstellen. Schaden wollten sie mit ihrer Beschwerde aber niemandem, ist sich Doris Liebscher sicher: »Die meisten Menschen, die schildern, welches Unrecht ihnen widerfahren ist, wünschen sich eine Entschuldigung und dass der Nachteil, der ihnen zugefügt wurde, wieder gutgemacht wird.« Und sie wünschen sich, dass ihnen und auch anderen eine solche Erfahrung künftig erspart bleibt.
Ein halbes Jahr nach Verabschiedung des LADG in Berlin sind bei den Behörden 108 Beschwerden auf Grundlage der neuen Regelung eingegangen. Dabei ging es um Sachverhalte, bei denen sich Menschen aus unterschiedlichsten Gründen von Behördenvertretern diskriminiert fühlten. Das teilte Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) am Donnerstag mit. 23 Beschwerden betrafen demnach die Polizei, acht die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) und sechs die Bürgerämter. Die anderen richteten sich gegen Gerichte, Finanzämter, das Amt für Einwanderung, das Jobcenter, Standes- oder Jugendämter.
In 43 Fällen fühlten sich Menschen aufgrund ihrer Herkunft diskriminiert. 27 Mal war das aufgrund von Behinderungen der Fall, 18 Mal aufgrund von Erkrankungen und zwölf Mal aufgrund des Geschlechts. Als Gründe für mutmaßliche Benachteiligungen nannten Bürger auch ihre sexuelle Identität, ihren sozialen Status oder ihr Alter.
Beispiele für alltägliche Benachteiligungen aufgrund von Behinderungen schildert Gabriele Bendzuck. Die Vorsitzende der Landesvereinigung Selbsthilfe Berlin berichtet von sehbehinderten Menschen, die auf ihren Assistenzhund angewiesen sind, diesen aber nicht mit in Behördengebäude nehmen dürften. Ein anderer Fall: Bei einer Auseinandersetzung im Öffentlichen Nahverkehr spricht der herbeigerufene Polizeibeamte bewusst zuerst mit dem DB-Sicherheitsdienst. Als der Betroffene versucht, sich zu Wort zu melden, wird ihm gesagt: »Halt den Mund!« Als sich der Polizist schließlich an ihn wendet und der Betroffene versucht, etwas zu sagen, äußert der Polizist, »es sei ihm scheißegal, dass er behindert sei«.
Viele solcher Fälle, so Bendzuck, finde man nicht auf spektakulären Videos, die dann Wellen der Empörung oder Solidarität auslösen. Die betroffenen Menschen müssten sich selbst helfen. Dabei soll sie das in seiner Form bundesweit einmalige Gesetz unterstützen und auch Ansprüche auf Schadenersatz gegen das Land ermöglichen. Wer sich diskriminiert fühlt, kann sich an die betroffene Behörde wenden oder an die von Doris Liebscher geleitete Ombudsstelle. Dann wird der Vorwurf geprüft und nach Lösungen gesucht.
»Wir haben das Gesetz nicht gemacht, um es uns über den Schreibtisch zu hängen«, erklärt Senator Behrendt während einer Online-Pressekonferenz mit der Selbsthilfe Berlin sowie zwei weiteren, in Berlin-Brandenburg aktiven Sozialverbänden am Mittwochnachmittag. Diese haben zum 3. Dezember, dem Tag der Menschen mit Behinderung, eine 50-seitige Broschüre vorgelegt, die die Schutzmechanismen des Gesetzes bekannter und Rechtsberater*innen in Berlin »fit« machen sollen für die Prozessvertretung von Betroffenen.
»Hier liegt ein scharfes Schwert auf dem Tisch«, sagt Gabriele Bendzuck. Ein Schwert, das dauerhaft zu einer wirklichen Veränderung im Umgang mit Diskriminierung beitragen könne.
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.