- Politik
- Flucht über das Mittelmeer
Wenn der Schrecken nicht nachlässt
Viele Migranten, die Europa erreichen, sind von ihrer gefährlichen Flucht traumatisiert
Der Kameruner Thomas wohnt seit einem Jahr in der andalusischen Stadt Cádiz, keine fünfhundert Meter vom Strand entfernt. Trotzdem geht der 32-Jährige so gut wie nie ans Meer. Wenn er doch mal die Strandpromenade entlang schlendert, schweift sein trauriger Blick über den Horizont des Mittelmeers. Mit Schweißperlen auf der Stirn schaut er auf ein Massengrab. »Wenn ich an die vielen afrikanischen Brüder denke, die im Meer ertrunken sind, dann frage ich mich: Warum? Warum müssen wir dieses Leben führen? Was haben wir getan? Bisher habe ich noch keine Antwort gefunden.«
Die schwierigen, oft lebensbedrohlichen Bedingungen einer Flucht traumatisieren Hunderttausende Afrikanerinnen und Afrikanern. Viele träumen von einem besseren Leben in Europa, bis sie in der Wüste verdursten. Womöglich verlieren ebenso viele ihr Leben bei dem Versuch, das Meer zu überqueren. Der Paderborner Psychotherapeut Martin Kolek wundert sich nicht, dass es keine vertrauenswürdigen Statistiken über das tägliche Sterben auf See gibt. Die Tragödien sind ein Massenphänomen, das ungezählt bleibt. Aber Martin Kolek will sie nicht ignorieren. Deshalb heuert er jedes Jahr während der Sommermonate als ehrenamtliches Besatzungsmitglied auf einem Seenot-Rettungsschiff an. »Zurzeit gehöre ich zum Team des Monitorseglers ›Nadir‹ im Mittelmeer. Das ist ein Schiff der Organisation Resq-Ship. Wir sind vor Ort und helfen allen Menschen, die in Not geraten, egal wo sie herkommen.«
Manchmal kommt die Hilfe zu spät. Dann muss der rotbärtige Heilpraktiker Leichen aus dem Wasser bergen. »Einmal konnten wir nur 22 von 45 Menschen in einem Boot retten. Zudem haben wir zwei Tote an Bord genommen. Die beiden Ertrunkenen schwammen in einem Autoschlauch, der senkrecht stand. Wenn ein Schlauch so steht, kann man sicher sein: Die Person da darin ist ertrunken.«
Martin Kolek sitzt in seinem Therapieraum, umgeben von farbenfrohen Bildern und zahlreichen Musikinstrumenten. Als diplomierter Musiktherapeut spezialisiert sich der 56-Jährige auf die Behandlung traumatisierter Kinder, Jugendlicher und Geflüchteter.

Der Kameruner Thomas wäre früher nie auf die Idee gekommen, die Hilfe eines Psychotherapeuten in Anspruch zu nehmen. Heute aber weiß er, dass Migration psychisch krank machen kann, nicht nur die Migranten selbst, sondern auch seine zurückgebliebene Familie: »Wenn der Sohn in Europa ankommt und anruft, freuen sich alle. Doch wenn er nicht anruft, weinen sie und beten. Früher, als es noch keine Mobiltelefone gab, wusste niemand, was geschehen ist. Aber wenn heutzutage ein Jahr vergeht, oder zwei oder drei, ohne dass ein Anruf kommt, dann wissen die Angehörigen, dass der Sohn im Meer gestorben ist.«
Schon nach wenigen Minuten will Thomas den Strand von Cádiz verlassen. Die rauschenden Wellen lösen quälende Erinnerungen in ihm aus. Der großgewachsene, kräftige Kameruner überquert eine Küstenstraße und betritt eine kleine Tapasbar. »Wenn die Regierungen der Welt nichts unternehmen, werden noch viel mehr Menschen sterben«, prophezeit er.
An einem Tisch des Restaurants sitzt eine Gruppe junger, afrikanischer Männer. Thomas nickt ihnen kurz zu, setzt sich dann aber an einen anderen Tisch. »Als ich nach Marokko kam, war das Leben dort hart«, erzählt er. »Aber zumindest gab es genug zu essen. Du kannst dort Arbeit finden, auch ohne Ausweispapiere.«
Viele Migranten in Marokko unternehmen immer wieder Versuche, um Spanien zu erreichen. Manche Klienten von Martin Kolek sind fünf- oder sechsmal in See gestochen. »Einer hat erzählt, dass ihn einmal die Küstenwache zurückgebracht hat. Dann eine Miliz. Danach musste er wieder arbeiten. Das hat ein halbes Jahr gedauert. Dann wieder los. Das eine Boot ist untergegangen. Sie wurden gerettet. Und wieder zurück. Als Zuhörer fragst du dich, wie ein Mensch das aushalten kann.«
Thomas erzählt, dass während seiner Zeit in Marokko an manchen Tagen zehn Personen aus seinem Bekanntenkreis nach Europa aufgebrochen sind. »Von denen schaffen es womöglich vier nach Spanien«, sagt er. »Fünf kommen zurück nach Marokko und einer stirbt. Das ist eine Tombola.«
Martin Kolek ist empört, dass die Weltgemeinschaft ein solches Glücksrad zulässt, das über Leben und Tod entscheidet. Aber die Zielstrebigkeit und das Durchhaltevermögen der Menschen beeindrucken ihn. Eine Rückkehr nach Hause schließen die meisten aus. »Es gibt diese Vorstellung, eine Rückkehr sei der selbstgewählte Tod. Nach rückwärts ist die Tür nicht offen. Es geht nur nach vorn.«
Bei seinem zweiten Versuch war sich auch Thomas sicher: Es wird kein Zurück geben, egal auf was für einem überfüllten, weitgehend hochseeuntauglichen Gummiboot er landet. »Als ich abends auf diesem Strand ankam, waren dort schon viele Menschen. Aber es kamen immer mehr. Wir sind dann alle in ein Boot gestiegen. 58 Personen. Neun Frauen und der Rest Männer und ein Baby.«
Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen beklagt, dass viele der aufblasbaren Gummiboote in China produziert und über den Internetdienst Alibaba als »Qualitätsflüchtlingsboote« beworben und verkauft werden. Auf See hat Martin Kolek sehr unterschiedliche Flüchtlingsboote gesehen. »Wenn es noch ein bisschen neu riecht und hinten ein Motor dran ist, der tatsächlich ganz ruhig klingt, und das Wasser ist noch ganz seicht, dann glauben alle: ›Wir werden irgendwie ankommen.‹ Die wenigsten Menschen aus den Subsahara-Gebieten können schwimmen.«
Das Boot von Thomas war vier Nächte und drei Tage unterwegs. Sein Ziel: Die Kanaren, eine spanische Inselgruppe vor der Südküste Marokkos. Auf so einem Boot gibt es keine Toiletten. Immer wieder muss sich jemand übergeben. Exkremente landen in Schuhen. Schuhe gehen über Bord. Es wird Nacht. »Die wenigsten Menschen haben je eine Nacht auf dem Meer verbracht«, sagt Martin Kolek. »Wenn es richtig dunkel wird, ist es einfach nur schwarz. Manchmal wussten wir: Da ist ein Boot. Wir hörten Schreie, konnten es aber einfach nicht sehen.«
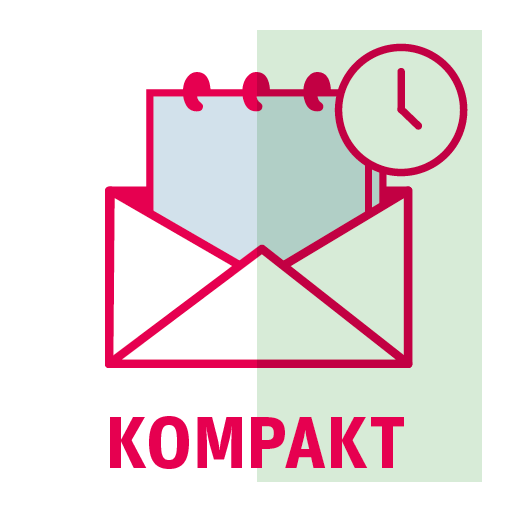
Unser täglicher Newsletter nd.Kompakt bringt Ordnung in den Nachrichtenwahnsinn. Sie erhalten jeden Tag einen Überblick zu den spannendsten Geschichten aus der Redaktion. Hier das kostenlose Abo holen.
Das Boot von Thomas hat es nicht bis zum Ziel geschafft. Nach drei Tagen funktionierte der Motor nicht mehr. »Du beginnst zu halluzinieren«, erinnert er sich. »Du weißt, dass du sterben wirst. Dann plötzlich erreichte uns ein Anruf vom Roten Kreuz in Deutschland. Die Stimme sagte: ›Bleibt ruhig und schickt uns eure Position per Whatsapp.‹ Irgendwann kam die Rettung. Wir waren nur wenige Kilometer von Gran Canaria entfernt, an einem Sonntag um acht Uhr morgens.«
Thomas erlebte seine Rettung wie einen Sieg: »Es war wie das Ende eines Kampfes: ›Sieg! Sieg!‹ Alle jubelten: ›Gott sei Dank. Danke, Danke. Dank sei Gott.‹«
Wenn Migranten an den Küsten Europas ankommen, ist ihr erster Kontakt häufig mit Beamten einer Sicherheitsbehörde. Auch Thomas wurde von einem Polizisten registriert. »Die Frau mit dem Baby kam sofort in ein Krankenhaus. Wir anderen kamen in eine Unterkunft. Dort blieben wir elf Tage lang.«
Nach der Entlassung aus dem Polizeigewahrsam wurde Thomas aufs spanische Festland gebracht. Dort nahm ihn die katholische Vereinigung Cardjín in Cádiz in Empfang. Vorerst ist seine Hoffnung auf ein Leben in Frieden, ohne Angst in Erfüllung gegangen. Er wohnt nun schon seit über einem Jahr in Cádiz. Einige der Mitarbeitenden der Vereinigung Cardjín bieten den afrikanischen Gästen an, über ihre traumatischen Reiseerfahrungen zu sprechen. Die belgische Sozialarbeiterin Katja Verardo bedauert, dass die meisten Männer ihre schrecklichen Erinnerungen lieber in einer dunklen Ecke ihres Bewusstseins verbergen: »Viele leiden unter heftigen posttraumatischen Belastungen. Aber anstatt darüber zu sprechen, sagen sie: ›Das liegt hinter mir. Ich schaue nach vorn. Das ist der Wille Gottes.‹«
Im Vergleich zu den meisten jungen Männern im Wohnheim ist Thomas sehr offen und gesprächsbereit. Er vertraut der freundlichen Belgierin mit den rostrot gefärbten Haaren. Aber er hat auch Zweifel, ob es ihm wirklich guttut, über seine Ängste und Trauer zu sprechen: »Einerseits fühlt es sich schlecht an, weil mich solche Gespräche an die Grauen der Reise erinnern. Andererseits bin ich froh, dass ich diese Erinnerungen so aus meinem Herzen herausholen kann. Das befreit meine Seele von all dem Bösen, das ich auf meinem Weg gesehen habe.«
Thomas betritt den Aufenthaltsraum des Wohnheims. Vier Männer sitzen auf zwei alten Sofas. Der Fernseher läuft, aber niemand schaut hin. Alle sind aus Westafrika nach Spanien gekommen. »Der da drüben heißt Yalo.« Thomas grüßt einen kräftigen Mann mit Stoppelbart. »Von ihm weiß ich, dass er vor drei Monaten auf einem Boot auf die Kanarischen Inseln gekommen ist, genauso wie ich. Mehr erzählt er nicht. Er will vergessen, was er gesehen hat.«
Yalo ist in Conakry aufgewachsen, der Hauptstadt von Guinea. »Thomas ist ein guter Freund«, sagt er. »Mit ihm habe ich nie Probleme. Wir haben dieselbe Reise hinter uns. Ich mag nicht darüber sprechen. Es war schwer. Daran will ich mich nicht erinnern.« Auf die Frage, ob er Menschen hat sterben sehen, antwortet Yalo: »Ja. Genau das möchte ich vergessen.«
Die häufigsten konkreten Ursachen für das Sterben auf See sind Ertrinken, Unterkühlung, Verdursten und das lang anhaltende Einatmen toxischer Gase aus veralteten Außenbordmotoren. Im Jahr 2023 gab es in 1900 Fällen konkrete Hinweise für den Tod von Migranten vor der spanischen Küste. Fünf Tote jeden Tag. Tatsächlich aber vermutet die Internationale Organisation für Migration, dass deutlich mehr Menschen bei dem Versuch umkommen, Spanien zu erreichen. Sie geht davon aus, dass für jede gefundene Leiche mindestens drei weitere nie auftauchen.
Der Therapeut Martin Kolek weiß aus Erfahrung, wie grausam das Meer sein kann: »Wenn ein Boot untergeht, ist es sofort weg. Auch die Leichen verschwinden schnell. Einmal sind wir an eine Stelle gekommen, an der kurz zuvor vierzig Menschen ertrunken sind. Ein Säugling war noch an der Oberfläche. Ich dachte erst, es sei eine Puppe, die im Wasser schwebt. Doch dann hatte ich ein totes Kind im Arm.«
Die Erinnerung an die kleine Leiche lässt den Therapeuten bis heute nicht los. Sie motiviert ihn aber auch, sich weiter für die wehrlosen Menschen auf dem Meer zu engagieren. Thomas hingegen hofft, dass der Schmerz der traurigen Erinnerungen bald nachlassen wird. »Es ist nicht einfach zu vergessen. Aber ich glaube, ich werde es schaffen.«
Wir haben einen Preis. Aber keinen Gewinn.
Die »nd.Genossenschaft« gehört den Menschen, die sie ermöglichen: unseren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die mit ihrem Beitrag linken Journalismus für alle sichern: ohne Gewinnmaximierung, Medienkonzern oder Tech-Milliardär.
Dank Ihrer Unterstützung können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen sichtbar machen, die sonst untergehen
→ Stimmen Gehör verschaffen, die oft überhört werden
→ Desinformation Fakten entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und vertiefen
Jetzt »Freiwillig zahlen« und die Finanzierung unserer solidarischen Zeitung unterstützen. Damit nd.bleibt.







