- Politik
- Flucht aus Afghanistan
Athen: Kein Ort zum Bleiben
Viele Geflüchtete aus Afghanistan stranden in Athen. Eine Perspektive haben sie dort nicht

Sahel wirkt erschöpft, wenn er seine Geschichte erzählt. Der 23-jährige Afghane aus der nördlichen Provinz Kundus kam Ende September in Athen an. Es war sein dritter Versuch oder wie Geflüchtete meistens ihre Flucht mittels Schleppern bezeichnen: sein drittes »Game«.
Mit einem Spiel haben die gefährlichen Wege nach Griechenland, Italien oder über die Balkanroute allerdings wenig gemein. Vielmehr handelt es sich meistens um Todeszonen – nicht nur, weil gefährliche Bergrouten und Bootsfahrten auf dem Meer die Reise erschweren, sondern auch wegen der Militarisierung des europäischen Grenzregimes. Bewaffnete und mit Drohnen sowie Wärmebildkameras ausgestattete Grenzwächter*innen verantworten regelmäßig brutale Pushbacks, die mit Leid und Tod enden.
»Viele versuchen es so oft, bis es klappt. Für Alleinreisende wie mich ist es einfacher. Familien, Frauen und Kinder, die mit meiner Gruppe unterwegs waren, wurden hingegen erwischt und misshandelt«, sagt Sahel, der seinen Nachnamen aus Angst vor den Behörden nicht nennen will. Er wirkt erschöpft und müde. Entlang des Evros, des Flusses, der die natürliche Grenze zwischen Griechenland und der Türkei bildet, gelangte Sahel mit einigen anderen Afghan*innen in die Europäische Union. Rund 2500 Euro pro Kopf kostete die Reise, und vorbei ist sie noch lange nicht. »Ich kann mir hier dauerhaft keine Zukunft vorstellen. Es gibt hier nichts«, resümiert der junge Mann nüchtern.
»Solange Fluchtursachen nicht anerkannt und effektiv bekämpft werden, wird sich auch nichts ändern.«
Liska Bernet Glocal Roots
Dass Sahel so denkt, ist nicht verwunderlich. In Griechenland existieren keine Strukturen, die Geflüchtete auffangen. Viele Menschen aus Afghanistan, Syrien und anderen Staaten bleiben undokumentiert, sind obdachlos und leben mal hier, mal da. Ihre Not wird oft von jenen ausgenutzt, die über Wohnraum verfügen. Dazu gehören auch Afghan*innen, die sich schon länger in Griechenland aufhalten. Gegenwärtig lebt Sahel mit zwölf weiteren Geflüchteten in einer Dreizimmerwohnung nahe dem Athener Viktoria-Platz. Für eine abgenutzte Bodenmatratze verlangt der Vermieter sieben Euro pro Nacht. Selbiges ist auch in mehreren afghanischen Restaurants der Fall. Sie verfügen meist über große Kellerräume. »Wie es dort unten riecht, willst du gar nicht wissen«, sagt Sahel. Zwischen 30 und 40 Geflüchtete würden nachts dort hausen.
In den letzten Jahren wurde die Gegend rund um den Platz, der nur wenige Kilometer von der Akropolis entfernt liegt, immer wieder zum Brennpunkt. 2015, während des großen Flüchtlingstrecks, war er gefüllt mit Tausenden obdachlosen Geflüchteten, die gerade auf dem europäischen Festland angekommen waren und in den Asylzentren keinen Platz fanden.
Obdachlose gibt es am Viktoriaplatz weiterhin, doch im Vergleich zu früher ist ihre Zahl zurückgegangen. »Hier herrschten apokalyptische Zustände, und wir waren mittendrin«, meint Salim, der eigentlich anders heißt. Er lebt mittlerweile in Deutschland und ist nun als Tourist in Griechenland. Dass die Situation nicht mehr so dramatisch ist, hat mehrere Gründe. Zum einen sind viele mit der Hoffnung auf ein besseres Leben in Zentraleuropa weitergezogen. Andererseits gibt es jetzt mehr Übernachtungsmöglichkeiten. Afghanische Geflüchtete wie Sahel finden diese meist über Mund-zu-Mund-Propaganda.
Wichtig sind dafür Treffpunkte wie das »Herat«, ein afghanisches Restaurant in der Gegend. »Ich bin gestern gekommen. Weißt du, was ich jetzt machen soll?«, murmelt ein Geflüchteter auf Paschtu während eines Gesprächs mit einem anderen jungen Afghanen. »Ich suche eine Wohnung für mich und meine Familie«, erklärt hingegen Amanullah Mohammadi, 28. Gemeinsam mit Frau, Kind und Tante kam er erst vor wenigen Stunden an. Auch der Keller des »Herat« wurde zum lukrativen Schlafraum umfunktioniert, in dem bis zu 30 Personen pro Nacht schlafen können.
»Dass die meisten Geflüchteten hier nur durchziehen, sollte niemanden überraschen. Vor allem jene, die nicht erst auf den Inseln, sondern direkt in Athen ankommen, sind den Realitäten der Stadt ausgesetzt«, sagt Liska Bernet. Die Schweizerin leitet die Nichtregierungsorganisation Glocal Roots, deren Büros sich im Victoria Community Center befinden, einer Anlaufstelle für alle Ankommenden. Dort werden Menschen mit Essens- und Getränkemarken versorgt, es gibt eine rechtliche Beratung und verschiedene Tagesprogramme.
Seit zehn Jahren ist Bernet an den europäischen Außengrenzen tätig. Die Flucht- und Migrationsdebatten in der Schweiz und den EU-Staaten sind für sie ein Armutszeugnis, sie hätten mit den Realitäten vor Ort wenig zu tun. »Solange Fluchtursachen nicht anerkannt und effektiv bekämpft werden, wird sich auch nichts ändern«, sagt sie. Bernet kann sich noch gut an Geflüchtete erinnern, die wenige Monate, nachdem sie in ihr Heimatland deportiert worden waren, wieder am Viktoria-Platz standen.
In Athen gibt es wohl kaum jemanden, der besser versteht, was Berent meint als Nasim Lomani. Vor 20 Jahren kam der Afghane in Griechenland an und blieb. Er lernte Griechisch, begann als Dolmetscher zu arbeiten und sich für die Rechte Geflüchteter einzusetzen. 2016 besetzte Lomani mit anderen Aktivist*innen ein leer stehendes Hotel nahe dem Viktoria-Platz, um Wohnmöglichkeiten für 400 Geflüchtete zu erzwingen.
»Niemand verlässt gerne seine Heimat. Doch solange es Gründe für die Flucht gibt, werden auch neue Möglichkeiten und Routen geschaffen werden. Dieser Kreislauf lässt sich mit der aktuellen Politik nicht durchbrechen«, sagt Lomani. Er verweist dabei nicht nur auf den Krieg in seiner afghanischen Heimat, sondern auch auf die aktuelle Situation im Nahen Osten. »80 Prozent der Leute, die in den letzten Monaten etwa auf Kos angekommen sind, stammen aus Gaza. Das wird so weitergehen, wenn das Massaker und die Vertreibungen dort nicht beendet werden.«
Ähnlich sieht das auch Lomanis Verlobte Hana Ganji, die mit ihm zuletzt nach Lesbos reiste, um die Lage vor Ort in Augenschein zu nehmen. Sie ist Mitgründerin der Initiative Hidden Goddess, die vor allem geflüchteten Frauen einen sicheren Ort und verschiedene Kurse anbietet. »Wir wollten, dass Geflüchtete Geflüchteten helfen, weil sie selbst am besten wissen, welchen Problemen und Traumata sie ausgesetzt sind. Uns geht es in erster Linie um Integration und konstruktive Arbeit«, erklärt Ganji. Mit ihren Kolleginnen versucht sie, die Angekommenen aufzufangen. »Hauptsache, weg von der Straße.«
Hinzu käme, so Lomani, dass rechte Politiker*innen keine Lösungen anbieten würden. »Insgesamt gibt es in Griechenland heute weniger Geflüchtete als früher. Wirtschaftliche, soziale und infrastrukturelle Probleme, für die manche sie verantwortlich machten, sind geblieben. In anderen europäischen Staaten, die sich jetzt abschotten wollen, wird Ähnliches der Fall sein«, prophezeit er.
Auch auf Inseln wie Lesbos, Samos oder Chios sei die Lage ruhiger, erklärt er. Doch all dies ist kein Grund zu beschönigen: Die Anzahl der Pushbacks ist in
den letzten Monaten und Jahren gestiegen. Menschenrechtsorganisationen
wie Amnesty International oder Human Rights Watch kritisieren die illegale behördliche Praxis seit Jahren. Vorfälle wie das Pylos-Schiffsunglück im Juni 2023, bei dem mehrere Hundert Flüchtende ums Leben kamen, werden dabei als Teil von Griechenlands systematischer Pushbackpolitik betrachtet.
Die Angst vor dieser Gewalt sucht Sahel bis heute heim. Sie war da, als er versuchte, nach Griechenland zu gelangen, und sie ist auch präsent, während er durch Athen spaziert. Wie die meisten Geflüchteten dort ist auch er nicht registriert, während Polizeistreifen umherschwirren. Seine größte Sorge: dass ihn Beamt*innen aufgreifen und monatelang in eines der berüchtigten Asylzentren sperren. »Die Zustände dort sind katastrophal«, betont auch Liska Bernet von Glocal Roots.
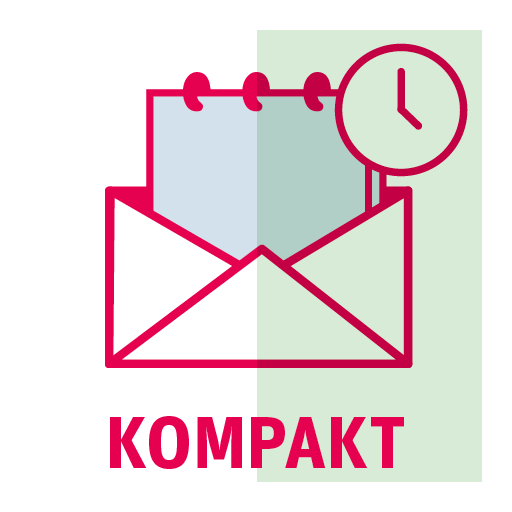
Unser täglicher Newsletter nd.Kompakt bringt Ordnung in den Nachrichtenwahnsinn. Sie erhalten jeden Tag einen Überblick zu den spannendsten Geschichten aus der Redaktion. Hier das kostenlose Abo holen.
»Ich möchte keine Probleme mit dem Gesetz, sondern mir etwas aufbauen«, sagt Sahel. In seiner Zeit in der Türkei arbeitete er illegal auf dem Bau, während er abends seiner Leidenschaft nachging: Der Comedian mit mehreren Tausend Followern auf Tiktok produzierte Content für seinen Kanal. »Mit dem Geld, das über Tiktok reinkam, konnte ich mir einen Teil meiner Flucht leisten«, sagt er stolz. Es ist das große Showbusiness, von dem Sahel weiterhin träumt. »Irgendwann«, sprich: nach seiner Reise, will er sich allein darauf konzentrieren, noch berühmter zu werden. Wenn er irgendwo angekommen ist, wo er in Ruhe leben kann.
Alles andere als ruhig ist seine Heimat. »In Afghanistan hätte ich nicht nur mit den Taliban Probleme. Weil ich in meinen Sketchen manchmal Frauenkleidung anlege, werde ich regelmäßig bedroht«, erzählt er. Seit der Rückkehr der militant-islamistischen Taliban an die Macht im August 2021 haben zahlreiche bekannte Medienpersönlichkeiten, darunter Sänger*innen und Moderator*innen sowie Journalist*innen, Musiker*innen und Comedians das Land verlassen.
Seither haben die Repressalien des Regimes zugenommen. Neben Arbeits- und Bildungsverboten in zahlreichen Branchen sind auch die Unterhaltungs- und Medienindustrie betroffen. »Es darf keine Musik mehr gespielt werden. Hochzeiten sind wie Beerdigungen. Sportarten werden eingeschränkt und sogar Social Media soll bald verboten werden«, sagt Sahel empört. »Die Taliban können dieses Afghanistan gerne für sich haben, für mich und viele andere junge Menschen gibt es dort keinen Platz mehr.«
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.







