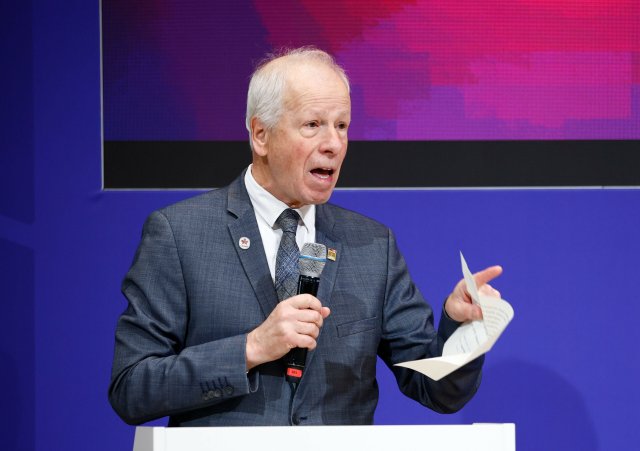Vor und nach Hartz
Sozialwissenschaftler fordern mehr Bildung für Beschäftigungslose
1969 war das »alte« Arbeitsförderungsgesetz noch einstimmig vom Bundestag verabschiedet worden. Frank Nullmeier vom Zentrum für Sozialpolitik an der Universität Bremen bewertet es als Bestandteil eines Gesamtkonzeptes, nach dem der Sozialstaat eher in seine Beschäftigten investierte als sie nur – wie heute – zu »aktivieren«. Das Gesetz von 1969 sei unter dem Motto »Bildung für alle« Teil der Bildungspolitik gewesen. Problematisch aus seiner Sicht war die Finanzierung aus Versicherungsbeiträgen und das Fehlen einer passenden organisatorischen Form. Schließlich sei das Gesetz vor allem ab 1990 dadurch entwertet worden, dass in den neuen Bundesländern ein Bildungsmarkt privater Träger entstand, die trotz schlechter Angebote gut verdienten. Nullmeier bewertete den vorliegenden Band als nüchterne wissenschaftliche Analyse der Hartz-Gesetze.
Wünsche an eine emanzipierende Arbeitsmarktpolitik nannten bei der Berliner Veranstaltung alle drei HerausgeberInnen. Arbeitnehmer via Bildung wettbewerbsfähig zu machen, ist für den Ökonomen Werner Sesselmeier von der Universität Koblenz-Landau keine sozialpolitische Romantik, sondern harte wirtschaftliche Notwendigkeit. Für Silke Bothfeld von der Hochschule Bremen sollte Arbeitsmarktpolitik nicht nur Lebensperspektiven eröffnen, sondern auch den Lebensstandard erhalten. Sie forderte dazu eine politische Debatte, die auch in Fragen der Gerechtigkeit neue Orientierung schaffen müsse.
Nach ihrer Beobachtung seien die Vermittlungsgespräche in der heutigen Form das Nadelöhr, welches den komplexen Lebenssituationen Arbeitsloser nicht gerecht werde. Hier sei mehr Beratung nötig. Auch andere verwaltungstechnische Instrumente der Agentur für Arbeit seien ungeeignet. Diese Kritik unterstützten auch Gewerkschafter, aus deren Sicht die Einführung interner Kontrollmechanismen à la McKinsey die Arbeitsmarktpolitik delegitimiert hat.
In der Debatte wurde die Weiterbildung Beschäftigter auch aus demografischen Gründen für notwendig erklärt. Ein Erwachsenen-BAföG könnte in diesen Lernzeiten die Existenz sichern. Das Verschwinden einfacher Tätigkeiten und die steigende Nachfrage nach besser gebildeten Arbeitskräften sprächen für eine entsprechende Bildungsoffensive. Gelöst werden müssten auch die Probleme der Jugendlichen ohne Lehrstelle oder Schulabschluss. Vorhandene Qualifikationen von Migranten sollten endlich anerkannt werden. Auch die Frauenerwerbsquote könne gesteigert werden.
Claudia Bogedan von der Hans-Böckler-Stiftung erwartete nach der Bestandsaufnahme in Buchform Schlussfolgerungen von der Politik, die sich demnach nicht auf reines Verwaltungshandeln zurückziehen dürfe.
Hrsg.: Bothfeld, Silke /Sesselmei- er, Werner / Bogedan, Claudia: Arbeitsmarktpolitik in der sozialen Marktwirtschaft. Vom Arbeitsförderungsgesetz zum Sozialgesetzbuch II und III, VS Verlag für Sozialwissenschaften, 319 Seiten, 39,90 Euro; erscheint am 15. 09.
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.