- Brandenburg
- 50 Jahre Mauerbau
Passkontrolleur am kürzeren Ende der Sonnenallee
Wolfgang Schneider arbeitete jahrelang an verschiedenen Grenzübergängen in der Hauptstadt der DDR
Gleich nebenan steht ein ziemlich langes Stück der Berliner Mauer, das längste, das es noch gibt. Bemalt wurden die Betonsegmente von Künstlern aus aller Welt und deswegen sind sie berühmt. Die Eastside Gallery ist ein Touristenmagnet. Kein Tag vergeht, an dem die Besucher nicht in Scharen herbeiströmen und fotografieren. Aber an der Oberbaumbrücke selbst erinnert nichts mehr an die Teilung der Stadt. Diese Brücke überspannt die Spree. Sie ist der einzige Verkehrsweg von Friedrichshain nach Kreuzberg. Hier befand sich einst ein Grenzübergang.
Wolfgang Schneider erinnert sich, wo die Baracke stand, in der die Passkontrolleure ihren Dienst versahen. Er war einer von ihnen, trug eine Uniform der Grenztruppen. Doch das war nur Tarnung. Die Passkontrolleure unterstanden dem Ministerium für Staatssicherheit. Damit gehörten sie zu einer Kaste, die heute unter pauschalen Vorurteilen leidet und auf Schritt und Tritt mit erheblichen Benachteiligungen rechnen muss. Besser, man hält sich vorsorglich ein wenig an die erlernten Regeln der Konspiration. Darum möchte Wolfgang Schneider sein Foto lieber nicht in der Zeitung sehen und auch seinen Namen nicht dort lesen. Darum nennen wir ihn hier Wolfgang Schneider, obwohl er eigentlich anders heißt.
Wolfgang Schneider ist jetzt 55 Jahre alt. Als die Mauer 1961 gebaut wurde, war er noch ein kleiner Junge und lebte gar nicht in Berlin. Er stammt aus Sachsen. Als er 1977 in die Hauptstadt der DDR zog und seinen Dienst als Passkontrolleur antrat, war die Mauer für ihn eine Selbstverständlichkeit, über die extra nachzudenken, sie gar in Frage zu stellen, sich überhaupt nicht lohnte. Mit dem Wissen, dass es sie gibt, ist er aufgewachsen.
Warum er an der Grenze stand, an der Nahtstelle von Sozialismus und Kapitalismus, das wusste Schneider allerdings bereits als junger Mann ganz genau. »Wir haben das Privateigentum an den Produktionsmitteln vergesellschaftet. Das war in den Augen des Westens eine Todsünde«, erzählt Schneider. »Mir war immer klar, wenn das Blatt sich einmal wendet, dann machen sie unsere Wirtschaft platt. Die brauchen den Osten nur als Absatzmarkt und Rohstoffquelle. Wir sind für die eine Kolonie.« Die Ereignisse nach 1989 bestätigten ihn in seiner Auffassung.
Das Klischee vom engstirnigen Stasi-Mann erfüllt Schneider weder von seiner äußeren Erscheinung noch von seiner nachdenklichen Art her. Er ist ein kritischer Geist, interessiert sich für den Umweltschutz und die Friedensbewegung, geht zu den Ostermärschen und anderen Demonstrationen. Soziale Gerechtigkeit und Solidarität sind ihm wichtig, für diese Ideale engagiert er sich.
Manchmal grübelt der 55-Jährige auch über Sinn und Zweck des Mauerbaus. »War es richtig, sich in dieser Form abzuschotten und sich nicht zu fragen, warum so viele weggelaufen sind?« Der Westen schien diesen Leuten attraktiver zu sein. Er präsentierte sich als trügerisches Schaufenster der Marktwirtschaft, lockte mit tollen Angeboten. Persönliche Gründe habe es wohl auch gegeben und Menschen, die einfach mal etwas anderes von der Welt sehen wollten, sagt Schneider. Aber da gab es auch die Studenten, weiß er, die bereits im ersten Semester planten, auf Kosten des Arbeiter- und Bauernstaats ihren Abschluss zu machen, aber gleich danach in die Bundesrepublik zu flüchten. Was hätte man gegen solche Erscheinungen besser unternehmen sollen, als die Staatsgrenze dicht zu machen? Schneider macht es sich nicht leicht mit den Antworten. Oft weiß er gar keine, die ihn selbst voll zufrieden stellen.
Von schikanöser Behandlung durch Passkontrolleure hat er Gerüchte gehört, selbst derartiges jedoch nicht erlebt. Dass Reisenden in den Koffer geschaut wird, das gebe es überall, bemerkt Schneider. Verbittert wirkt er nicht, obwohl er Grund dazu hätte. Das Schicksal spielte ihm übel mit. Dem beruflichen Absturz folgte das Zerwürfnis in der Familie. Hätte es die Wende nicht gegeben, dann hätte seine Ehe wahrscheinlich gehalten, vermutet der 55-Jährige, der es schwer hatte, sich in der neuen Welt zurecht zu finden. Die Wende erlebte Schneider wie einen Albtraum. Von einem Tag auf den nächsten verwandelte er sich ohne eigenes Zutun von einem geachteten Mitglied der Gesellschaft quasi in einen Aussätzigen, der seine Identität nicht verleugnen konnte und sich überall rechtfertigen sollte.
Facharbeiter für Datenverarbeitung hat Schneider ursprünglich gelernt. Wie er damit zum Ministerium für Staatssicherheit gelangte, vermag er heute nicht mehr zu sagen. Ob er sich selbst beworben hat oder angesprochen wurde? Schneider zuckt mit den Schultern. Er kann sich nicht darauf besinnen.
Von 1977 bis 1980 kontrollierte Schneider die Pässe von Westberlinern und ausreisenden DDR-Bürgern. Er tat es an der Oberbaumbrücke, wo nur Fußgänger hinüber durften, und an der Treptower Sonnenallee, wo auch Autos passierten. An jenem Grenzübergang im Jahr 1973 spielt der Film »Sonnenallee«. Regisseur Leander Haußmann drehte ihn 1999. Schauspieler wie Katharina Thalbach und Henry Hübchen wirkten in der Komödie mit. Bis 2003 sahen allein in Deutschland 2,6 Millionen Kinobesucher diesen Streifen. Doch Wolfgang Schneider gehörte nicht zu den Zuschauern. Er weiß lediglich, dass es diesen Film gibt. Gesehen hat er ihn nie. Auch Thomas Brussigs Roman »Am kürzeren Ende der Sonnenallee« hat er nicht gelesen.
Die Arbeit des Passkontrolleurs erwies sich als ziemlich langweilig. »Jeden Tag ein anderes Datum«, scherzten die Kollegen über die wenig abwechslungsreiche Tätigkeit. 1980 gelang Schneider die Versetzung in den Hauptsitz des Ministeriums an der Normannenstraße. Die Arbeit dort gestaltete sich anspruchsvoller. Das gefiel ihm viel besser. Nach Details der Tätigkeit befragt, antwortet Schneider knapp: »Auswertung, nichts besonderes«. Mehr lässt er sich dazu nicht entlocken. Dabei ist er sonst ein Mensch, der ziemlich freimütig Auskunft gibt. Die Einsilbigkeit in Bezug auf die frühere Tätigkeit lässt sich bei vielen ehemaligen Stasi-Mitarbeitern beobachten. Ist das eine Nachwirkung der antrainierten Geheimhaltung oder spielen negative Erfahrungen bei einer Offenbarung nach der Wende mit hinein? »Es wird wohl von beidem etwas dabei sein«, glaubt Schneider.
Nach dem Mauerfall im Herbst 1989 wurde Schneider noch einmal kurz an die Grenze versetzt, an die provisorischen Durchlässe. »Dabei hieß es aber schon: Sucht euch eine andere Arbeit.« Schneider hat das getan. Er kam bei der Bahnpost unter, stellte ein halbes Jahr Pakete zu. Viele alte Kollegen traf er hier wieder. Die Bahnpost freute sich anfangs über die fleißigen neuen Mitarbeiter. Vorher waren schlecht zuverlässige Arbeitskräfte zu finden. »Da gab es Alkoholiker, die oft bummelten.« Doch wegen ihrer Vergangenheit durften die Stasi-Leute nicht bleiben. Das sei ihnen ganz offen so gesagt worden, berichtet Schneider. Er verdiente sich seine Brötchen einige Zeit lang bei einer Reinigungsfirma, doch die ging dann Pleite.
Schneider sitzt in der Kantine eines Berliner Jobcenters. Er musste in dem Gebäude wieder einmal Unterlagen abgeben. Eine Qualifizierung hat er gerade sehr erfolgreich absolviert. Nun hofft er nach Jahren der Erwerbslosigkeit, endlich einen Job zu bekommen. In der betreffenden Branche werden Leute inzwischen eigentlich händeringend gesucht. Doch für Schneider hat sich noch nichts gefunden. Scheitert es wieder an seiner Vergangenheit?
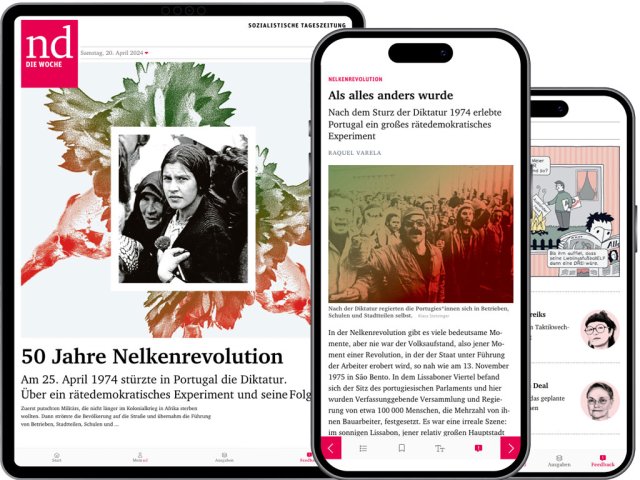
In der neuen App »nd.Digital« lesen Sie alle Ausgaben des »nd« ganz bequem online und offline. Die App ist frei von Werbung und ohne Tracking. Sie ist verfügbar für iOS (zum Download im Apple-Store), Android (zum Download im Google Play Store) und als Web-Version im Browser (zur Web-Version). Weitere Hinweise und FAQs auf dasnd.de/digital.
Das »nd« bleibt gefährdet
Mit deiner Hilfe hat sich das »nd« zukunftsfähig aufgestellt. Dafür sagen wir danke. Und trotzdem haben wir schlechte Nachrichten. In Zeiten wie diesen bleibt eine linke Zeitung wie unsere gefährdet. Auch wenn die wirtschaftliche Entwicklung nach oben zeigt, besteht eine niedrige, sechsstellige Lücke zum Jahresende. Dein Beitrag ermöglicht uns zu recherchieren, zu schreiben und zu publizieren. Zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit deiner Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Sei Teil der solidarischen Finanzierung und unterstütze das »nd« mit einem Beitrag deiner Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.
Vielen Dank!



