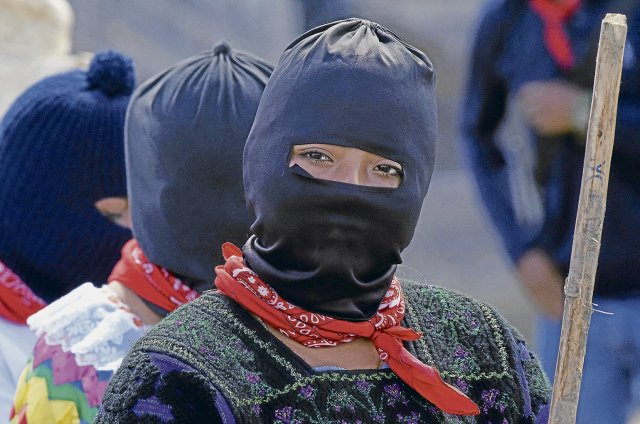- Politik
- Warum die Parteienkommission FDP-Ansprüche auf Vermögen von DDR-Blockparteien ablehnt
Den „großen Knüppel“ in der Hinterhand
„Die F.D.P. hat keinen Anspruch auf Freigabe von Vermögenswerten der NDPD und der LDPD, weil sie das Vermögen dieser Parteien nicht rechtswirksam erworben hat.“ Dieser Beschluß, den die Kommission zur Überprüfung des Vermögens der Parteien und Massenorganisationen der DDR vorige Woche faßte, kam nicht überraschend.
Denn erstens bestreitet die Kommission der PDS als Rechtsnachfolgerin der SED mit nur juristisch garnierter politischer Begründung generell den „materiell-rechtsstaatlichen Erwerb“ von Parteivermögen. Da könnte sie kaum plausibel begründen, wieso dies den engstens mit der SED verbundenen Blockparteien möglich gewesen sein sollte. Zumal auch deren rein materielles Überleben nur durch üppige Finanzspritzen aus dem DDR-Staatshaushalt (und z.T. direkt aus SED-Kassen) gesichert wurde.
Zweitens üben die SPD, die zwar dank Treuhand-Fürsorge Millionen aus dem Verkauf früherer SED-Verlage und -druckereien einsackte, und die CDU, die mit moralischem Pathos (doch erst nach Ver-
brauch der Geldbestände) auf das Erbe von Ost-CDU und DBD verzichtete, Druck auf die FDP aus, analoges zu tun. Freilich bisher vergeblich.
Da die FDP überdies der Kommission mit Klage gedroht hatte, falls sie deren Ansprüche auf das Vermögen der von ihr vereinnahmten Blockparteien nicht anerkennt, mußte die nun ihren Beschluß nolens volens juristisch begründen: „Zwischen der NDPD und dem B.F.D. (so hatte sich die LDPD umbenannt - d. A.) sowie zwischen dem B.F.D. und der F.D.P. hat keine wirksame Vermögensübertragung stattgefunden.“
Die Kommission befand:
1. „Eine Fusion von Parteien begründet... keine automatische Vermögensübernahme der aufnehmenden Partei.“
2. Eine Übertragung von Grundstückseigentum war in der DDR „darüber hinaus nur durch staatlich genehmigten-Vertrag möglich“, was jedoch nicht erfolgte.
Dem setzte FDP-Generalsekretär Lühr eine Polemik um § 13 a des DDR-Parteiengesetzes entgegen. Durch diese hastig von der letzten DDR-Volkskammer erlassene Zu-
satzbestimmung wurde in der Tat der Zusammenschluß von Parteien der DDR und der BRD „zulässig“. Und sie legte auch fest, daß so entstandene „gesamtdeutsche“ Parteien „die Gesamtrechtsnachfolge“ ihrer Vorgänger antreten, womit die FDP offenbar ihre Ansprüche begründet.
Laut Lühr geht der Streit mit der Kommission nur darum, ob diese Bestimmungen schon gültig waren, als sich am 11. 8.1990 der B.F.D. der FDP der BRD anschloß. Im Text des Gesetzes war nämlich festgelegt, daß es „mit seiner Veröffentlichung“ in Kraft tritt. Und die erfolgte nicht, wie auf dem Gesetzblatt vermerkt, am 9.8., sondern wegen verspäteter Auslieferung durch die Druckerei erst am 14. oder 15.8. Damit zu argumentieren, so Lühr, sei „schwach und an der Grenze der Lächerlichkeit“.
Doch der Kommissionsvorsitzende Prof. Papier war auf jenen § 13 a in seiner Presseerklärung überhaupt nicht eingegangen. Vielmehr hieß es dort nur lakonisch, die Kommission habe in ihrer Sitzung am Dienstag vergangener Woche „keine Entscheidung zur
Frage der Wirksamkeit der Beitrittsbeschlüsse getroffen“. Noch keine, wie Prof. Papier auf Nachfrage bestätigte. Da werde wohl in der Hinterhand mit dem „großen Knüppel“ gedroht, fragte ein Journalist und bekam mit einem vielsagenden Lächeln zur Antwort: Ginge die FDP, wie angekündigt, wirklich vor Gericht, müsse die Kommission diese Frage entscheiden.
Das ist eindeutig. Denn die „Wirksamkeit der Beitrittsbeschlüsse“ - der Plural weist darauf hin, daß es auch um den Anschluß der NDPD an den B.F.D. am 28. 3.1990 geht - ist in der Tat mehr als fraglich. ND hatte darauf schon am 3. und 12. 6.1992 in zwei Beiträgen hingewiesen: Beide „Beitritte“ entsprachen nämlich nicht den in § 10 (2) des DDR-Parteiengesetzes festgelegten Anforderungen. Eindeutig heißt es dort: „Die Mitgliederversammlung oder die Delegiertenkonferenz (Parteitag) beschließt über... die Auflösung und den Zusammenschluß mit anderen Parteien.“ Das erfolgte in beiden Fällen nicht korrekt.
Die Konsequenz: Da beide „Beitritte“ nicht gesetzeskon-
form vollzogen wurden, waren sie - nach streng rechtstaatlichen Maßstäben - unwirksam. De jure war die - „gesamtdeutsche“ - FDP in der DDR bis zu deren Ende gar nicht existent. Würde das durch einen Prozeß gerichtsnotorisch festgestellt, könnte das für die FDP politisch weitreichende Folgen haben, was übrigens, ohne konkret zu werden, auch Prof. Papier anmerkte.
Ein Beispiel: Nur in der DDR rechtmäßig registrierte Parteien durften für die Landtagswahlen am 14.10.1990 in Ostdeutschland, die auf der Grundlage des Länderwahlgesetzes der DDR stattfanden, Kandidaten per Landeslisten oder Kreiswahlvorschlägen nominieren. Die FDP kam so zu 42 Mandaten. Die wären null und nichtig, wenn...
In diesem Lichte ist auch der letzte Satz des Kommissionsbeschlusses zu den FDP-Ansprüchen eindeutig: „Der Auftrag an den Vorsitzenden..., der F.D.P. diesen Beschluß zu erläutern, soll der F.D.P. die Möglichkeit eröffnen, ihr weiteres Vorgehen nochmals zu überprüfen.“ Man darf gespannt sein, ob sie wirklich vor Gericht zieht.
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.