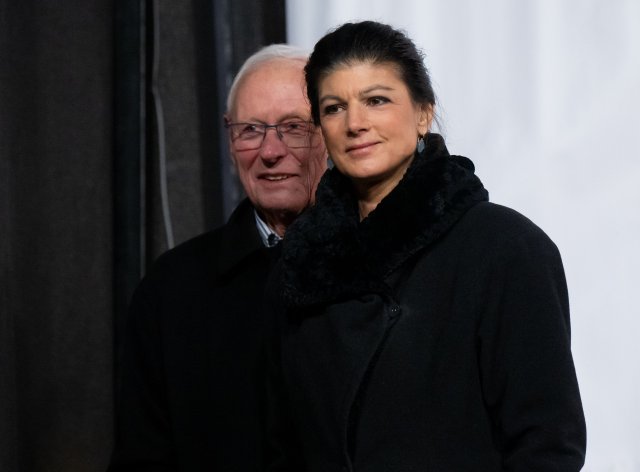Ghana wurde zumAbfalleimer der Welt gemacht
Etwa 150 000 Tonnen Altkleider allein aus Deutschland landen alljährlich auf Afrikas Märkten
Von KURT STENGER
„Präsident Rawlings und seine Freunde haben Ghana zum Abfalleimer der Welt gemacht“, sagt Menschenrechtsaktivist Kwesi Pratt jr. „Die meisten Leute sind abhängig von Second-Hand-Kleidung, -Kühlschränken, -Autoersatzteilen und -Unterwäsche als Ergebnis einer gedankenlosen Wirtschaftspolitik.“
Was der 41jährige Ghanaer, der wegen seiner unbequemen politischen Arbeit bereits 14mal inhaftiert war, kritisiert, sticht beim Gang über einen der 26 prall gefüllten Märkte in der Hauptstadt Accra sofort ins Auge. Auf dem Makola-Markt im Zentrum der Stadt bieten viele Straßenhändlerinnen Second-Hand-Kleidung aller Art und zu günstigen Preisen an: Ein T-Shirt erster Qualität gibt es schon für 1000 Cedis (etwa 1,60 DM) zu kaufen, einen Anzug für 50 000 Cedis.
ter den Strä
oft nur schwer auszumachen sind und auch zu Stoßzeiten von kaum einem Kunden betreten werden, kostet ein neues T-Shirt „Made in Ghana“ mindestens das Fünffache, ein Anzug das Doppelte.
„Die einheimische Textilindustrie kann nichts verkaufen, weil niemand mehr genug Geld hat,“ weiß Kwesi Pratt jr Selbst in der Mittelschicht ist die Kaufkraft erheblich gesunken, seit in Ghana mit blutiger Repression gegen die Linksopposition von Ex-Militärdiktator Rawlings Programme von IWF und Weltbank durchgesetzt wurden. Sie beinhalten den Abbau von Subventionen, der auch die Textilindustrie traf. Die gestiegenen Produktions-
preise werden an den Markt weitergegeben, der wegen der Streichung von Importzöllen mit Billigware aus aller Welt überschwemmt wird.
200 000 Arbeiter wurden seit 1983 im Lande entlassen. In der Textilindustrie wurden die Staatsbetriebe entweder privatisiert oder - wie TAMS, Glamour, NENAK Industries und Universal Industries - geschlossen. Die Zahl der Beschäftigten in dem Sektor sank von über 20 000 Anfang der 80er Jahre auf 10 000 heute. Betroffen sind aber auch das traditionelle Schneiderhandwerk und die 30 000 Baumwollfarmer, die 1992 von den Textilherstellern nicht mehr bezahlt werden konnten.
Vom weitgehenden Zusammenbruch der einheimischen Industrie profitieren einige ghanaische Händler Die großen Gewinne machen jedoch die Lieferanten in Europa und Nordamerika. Wie der Sektor boomt, zeigt das Beispiel Deutschland: Betrug der Wert der Altkleider-Exporte nach Ghana 1981 noch 35 000 DM, lag er 1992 bei fünf Mio. DM. Für ganz Afrika strichen deutsche Exporteure für 120 000 bis 170 000 Tonnen Kleider etwa 300 Mio. DM ein. Gegenwärtig entsteht in Osteuropa ein neuer, schnell wachsender Absatzmarkt.
Bei den Anbietern der Second-Hand-Kleidung handelt es sich um ca. 100 Sortierfir-
men, die vor allem Altkleider zweiter und dritter Qualität für 2500 DM pro Tonne exportieren. Sie kaufen die Ware für 600 DM pro Tonne bei den Sammlern - kommerziellen Unternehmen wie auch karitativen Organisationen -, die die Kleider kostenlos von den Privathaushalten bekommen.
Selbst die karitativen Sammler bringen höchstens 20 Prozent direkt an Bedürftige. Beim Deutschen Roten Kreuz, dem größten unter ihnen, sind es nur 10 Prozent. „Die Karitativen müssen sich endlich verantwortlich fühlen für das von ihnen Gesammelte“, fordert Friedel Hütz, Mitarbeiter des Vereins Südwind, der mit der Studie „Der Deutschen alte
Kleider“ erstmalig auf die Problematik hingewiesen hat. Inzwischen gab es vier Tagungen mit karitativen Organisationen, die immerhin dazu führten, „daß etwa ein Dutzend über Veränderungen wie den Ausbau eigener Recyclingkapazitäten nachdenkt.“ Dies dauere aber, denn ganze Abteilungen hingen vom Altkleiderverkauf ab, und daraus werde ein Teil der eigenen Arbeit finanziert.
Fragwürdig ist zudem das Konsumverhalten der Bürger. Etwa 150 000 Tonnen, die Hälfte der abgegebenen Altkleider, haben noch zwei Drittel ihrer Lebensdauer vor sich. Würden sie nicht in den Second-Hand-Markt gehen, müßten sie entsorgt werden. Schon heute besteht aber zwei Prozent des hiesigen Mülls aus Altkleidern. In den nächsten Jahren ist mit einer Gesetzesinitiative nach Vorbild des Grünen Punktes zu rechnen.
Wer verhindern will, daß die abgegebenen Altkleider zur Geschäftswäre werden, sollte “ sie direkt zu Obdachlosenoder Flüchtlingsinitiativen bringen, rät Friedel Hütz. Zumindest kann man nachfragen, wofür die eingesammelte Kleidung verwendet wird. Vor allem kleinere Organisationen liefern sie aber auch an Partner im Süden, die sie zu einem geringem Preis an Slumbewohner oder Flüchtlinge weiterverkaufen, die sich keine neue Kleidung leisten können.
Kwesi Pratt, der ghanaische Menschenrechtler, erwartet keine Lösungen, solange die globale Schieflage als Ursache des Problems fortbesteht: „Die Lebenssituation im Norden mußte sich noch nie verändern. Strukturanpassungsprogramme gibt es dort nicht.“
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.