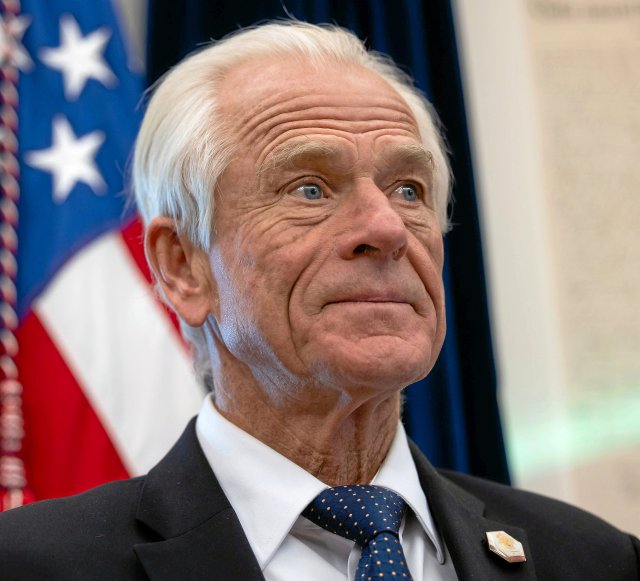«Wir können nicht anders, als zu helfen»
Als «Gefängnis» oder «Anstalt» wurde das Flüchtlingslager Moria nicht nur von Bewohnern bezeichnet. Ein Besuch
Wie ein Boxer nach dem Kampf sitzt Mohammed Qasim auf seinem Plastikstuhl. Zurückgelehnt pafft er Rauchwolken seiner Shisha in die Mittagshitze. Es riecht nach Bratfett und Urin vor den Toren Morias. Das Flüchtlingslager auf der Insel Lesbos gehört zu den größten in Griechenland. Wer es nach einer Frist von 25 Tagen verlassen darf, hält sich außerhalb des Camps auf.
Entlang der Straße zur Hauptstadt Mytilini hat eine Gruppe Geflüchteter eine lokale Wasserleitung gekappt. Die Wasserfontäne dient als improvisierte Dusche. Seit zwei Tagen gibt es kein fließend Wasser mehr, berichtet Mohammed. Nichts Neues. Manchmal bleibe das Wasser aus der Leitung für eine ganze Woche weg. Entlang der vier Meter hohen Maschendrahtzäune sitzen Geflüchtete um Essensstände. Es gibt Falafel und Brathähnchen. Essen, das mehr nach Heimat schmeckt, als die massenproduzierten Portionen der griechischen Armee. «Was sie uns geben, essen nicht einmal die Hunde», klagt Mohammed und verzieht sein Gesicht. Dass es Mittel enthalte, «um uns ruhig zu stellen», ist eines der vielen Gerüchte in Moria. Auch der Iraker behauptet das und dippt seine Pommes in rosafarbenes Ketchup. Seine Hand ist bandagiert seit der Massenschlägerei letzte Nacht. Fast täglich komme es zu Auseinandersetzungen: zwischen den verschiedenen Nationen, der Polizei und Protestierenden, und oft genug prallt die Frustration von allen Seiten zusammen. «Wir kämpfen, weil uns sonst keiner zuhört», sagt Mohammed, «die Polizei schützt uns nicht, wir müssen uns selbst wehren.» Dann zieht er sein Smartphone aus der Hosentasche, mit einem zwei Zentimeter langen Einstich auf dem Bildschirm. Es war vor ein paar Tagen der einzige Schutz vor der Messerattacke.
Eine Woche später brennen Mohammeds Zelt und rund 60 Prozent des Flüchtlingscamps ab. Es ist nicht das erste Feuer in Moria. Frustration, Überfüllung und die Abwesenheit von verlässlichen Informationen hatten immer wieder gewaltvolle Ausbrüche provoziert. Der Brand am 19. September war laut Nachrichtenagentur ANA Spannungen geschuldet, die sich über Wochen angestaut hatten. Nicht nur Flüchtlinge protestierten an diesem Montag, sondern auch rund 500 Bewohner Morias. Als gegen Abend frustrierte Camp- und Dorfbewohner aufeinander treffen, geriet die Situation außer Kontrolle.
Bilder vom ehemaligen Urlaubsparadies Lesbos gehen um die Welt, als Schauplatz griechischer Hilflosigkeit. Internetvideos zeigen Geflüchtete, die nach der Evakuierung des Camps ihre abgebrannten Zelte in Schlamm und Asche vorfinden. 800 Personen sind Monate nach ihrer Flucht wieder heimatlos.
«Es war nur eine Frage der Zeit», meldet sich nach dem Vorfall der Bürgermeister von Lesbos, Galinos Spyros, zu Wort. Seit Monaten warnen Organisationen, Journalisten und Inselbewohner vor den Zuständen im Camp, für das die Akteure verschiedene, alarmierende Worte finden: «Gefängnis», «Anstalt», «unmenschlich», sagen Ärzte ohne Grenzen, und «nicht mal für Tiere geeignet» heißt es im jüngsten Bericht von Human Rights Watch: ein Ort, «von Chaos und Unsicherheit geprägt».
Gerüchte befeuern die angespannte Situation. Außerhalb des Camps wollen Inselbewohner gesehen haben, wie ein neues und drittes Aufnahmelager gebaut wird. Innerhalb des Camps befürchten Asylsuchende währenddessen eine Massenabschiebung.
Am schlimmsten sei die Ungerechtigkeit, erklärt Al Mamun, der nur seinen Nachnamen nennen möchte. Der 44-jährige pakistanische Arzt fürchtet sich vor den Taliban, sogar im Flüchtlingscamp tausende Kilometer von seinem Heimatort. Er sieht sich als einen der großen Verlierer des EU-Türkei-Abkommens. Kategorisch betrachten die griechischen Behörden Pakistani als Wirtschaftsmigranten. Ihr Asylantrag bleibt meist erfolglos. Nach der Verordnung droht ihnen die Abschiebung in die Türkei und von dort zurück nach Pakistan. «Dann bringt uns lieber hier um, bevor ihr uns zurückschickt», sagt Al Mamun und mehrere junge, asiatische Männer nicken bestärkend. Sie sind sauer: auf die Behörden, auf die bevorzugten Syrer, die per Charterflug nach Deutschland geflogen werden, und vor allem auf die Politiker der EU. Es sei ein «Handel mit Menschen», ärgert sich einer in der Runde, und der Pakistani entgegnet: «Wir alle haben einen Grund, dass wir diesen Weg auf uns genommen haben.» Sieben Mal sei er knapp dem Tod entkommen. «Ich habe Angst» sagt der Vater von drei Töchtern, als sich die jungen Männer wieder dem Kartenspiel widmen.
«Ich will einfach nur noch weg aus Moria», sagt Lamine. Sein ganzes Vermögen, umgerechnet 5000 Euro, zahlte der Senegalese den Schmugglern für ein besseres Leben. Monatelang bestand sein Tagesablauf darin, sich stundenlang für Essen anzustellen und den Rest des Tages zu schlafen, «um keinen Hunger zu haben». Nun reicht sein Geld nicht einmal für den Bus nach Mytilini, der Hauptstadt von Lesbos. Zu Fuß läuft der Senegalese regelmäßig 15 Kilometer zum Hafen.
Eine drei Meter hohe Umzäunung trennt die ankommenden Touristen von verzweifelten Geflüchteten. Es sind rund 50 junge Männer verschiedener Nationalitäten, die das Hafengeschehen beobachten, als würden sie sich jedes Detail einprägen wollen. Eine Kolonne von Lkw wartet vor dem majestätischen Passagierschiff. In einem der Container befänden sich sechs seiner Freunde, flüstert Lamine, als könnte der Polizeibeamte mit Sonnenbrille auf dem Hafenplatz ihn hören. Letzte Nacht hätten sie sich in den Lebensmittelwagen geschmuggelt. «Meistens wissen die Fahrer Bescheid», sagt Lamine ohne den Blick von der Fahrzeugschlange zu wenden. Wenn sie Geld nehmen würden, wären sie Schlepper und bekämen Probleme, erklärt er: «Wahrscheinlich haben sie Mitleid oder schauen einfach nur weg», sagt er und spielt mit dem Telefon in seinen Händen. Noch keine Nachricht. Ein gutes Zeichen. Als der rote Lkw an der Reihe ist, wird es still hinter den Gittern. Ein Polizeibeamter mit weißen Handschuhen durchsucht das Cockpit des Lasters und schaut unter das Fahrzeug. Als er den Lkw Richtung Laderampe winkt, triumphieren die jungen Männer hinter der Umzäunung leise. Beim nächsten Lkw ziehen die Grenzpolizisten zwei Flüchtlinge aus einem Abfallcontainer. «Wenn sie Pech haben, landen sie in Gewahrsam», sagt Lamine und zuckt mit den Schultern: «Kann nicht schlimmer sein als Moria.»
Die Mehrheit der Asylsuchenden soll auf schnellstem Wege die Insel verlassen. Darauf einigten sich die Vertreter von Polizei, öffentlichen Behörden und Inselbewohnern bei einem Krisentreffen in Mytilini nach dem Brand. Die Gastfreundschaft der Insel sei ausgeschöpft, so der Konsens. In den Lagern Kapa Tere und Moria wohnen derzeit fast 6000 Geflüchtete, beinahe doppelt so viele wie geplant. Durchschnittlich verlassen knapp 50 Asylsuchende auf legalem Weg die Insel. Die Überfüllung der Camps nennt der Bürgermeister Galinos eine direkte Bedrohung für den sozialen Zusammenhalt und die Sicherheit. «Wir können die Situation nicht alleine bewältigen, macht auch die Regionalgouverneurin Christiana Kalogirou gegenüber dem lokalen Fernsehsender Skai TV deutlich: »Die Inselbewohner können nicht mehr.«
»Natürlich wollen wir helfen, aber wir haben auch unsere eigenen Existenzkämpfe«, betont Nikos. Der Busfahrer und ehemalige Hotelbesitzer berichtet von Demonstrationen in seinem Heimatort Molyvos. Vor allem im Norden des Landes würden Dorfbewohner gegen internationale Organisationen und Flüchtlingspolitik demonstrieren, oft genug angeheizt durch die rechte Partei »Goldene Morgenröte«. Medien berichten von bis zu 80 Prozent ausgebliebenen Touristen. Der lokale Hotelverband kalkuliert für 2016 mit einem Verlust von knapp 800 000 Tagesgehältern. Zur gleichen Zeit steigen die Steuern und zwingen Hotel- und Cafébesitzer, die Preise zu erhöhen. Nach der Wirtschaftskrise sei die Migrationskrise der »finale Todesschuss«, so Nikos, der jetzt für eine humanitäre Organisation arbeitet.
»Dieser Ort hat sich verändert«, sagt Anna Tascha Larsson in einem Café in Skala Sykamines. Im Hintergrund trennt der acht Kilometer breite Seeweg Griechenland von der türkischen Küste. Seit dem letzten Sommer passierten eine halbe Million Asylsuchende den 80-Seelen-Ort, erklärt die Helferin und Mitgründerin der Organisation Lighthouse Relief. Inzwischen hat Ruhe den Ausnahmezustand abgelöst. Nach dem Abkommen im März verschwanden nicht nur die Touristen, sondern auch viele der freiwilligen Helfer: »Jetzt sind die Dorfbewohner mit ihren Problemen alleine.« Schon vor einem Jahr waren sie die humanitären Helfer der ersten Stunde, Wochen bevor der UNHCR ein Aufnahmelager eröffnete.
»Wir sind es gewohnt, dass fremde Menschen mitten in der Nacht an Land kommen«, erklärt Maritsa Mavrapidi. Mit Migration kenne sie sich aus, und seit sie für den Friedensnobelpreis nominiert ist auch mit Interviews. Mit Küsschen begrüßt die 85-Jährige einen britischen Filmemacher in ihrem Steinhaus am Dorfrand. Umsäumt von Tomatenpflanzen und wildem Wein thront sie auf einem Plastikstuhl und wartet geduldig bis sie verkabelt wird. Sie streift die Arbeitsjacke ab und setzt sich noch ein bisschen aufrechter, als die Aufnahme beginnt. Dann berichtet sie von bis zu 15 Booten täglich und Kindern, die sie nie vergessen wird. Die Enkeltochter muss sie immer wieder unterbrechen, um zu übersetzen. Maritsa hat viel zu erzählen vom letzten Jahr, seit ein Bild von ihr um die Welt ging. Die Fotografie von Lefteris Partselis auf dem sonnengebleichten Gartentisch zeigt Maritsa und zwei ältere Damen, wie sie vor einem Flüchtlingsboot ein Neugeborenes im Arm halten, »damit die Mutter sich in Ruhe umziehen konnte«. Von humanitärer Hilfe und großen Organisationen habe sie keine Ahnung, aber vom Muttersein: »Sie wollen nicht unser Geld, sondern nur Geborgenheit«, sagt die Mutter von drei Kindern und Großmutter.
Maritsas Familie kam in den 20er Jahren in Booten auf demselben Seeweg nach Lesbos wie die Flüchtlinge heute. Schon immer war das Ägäische Meer Transitgebiet: für Kriegsflüchtlinge, Saisonarbeiter, Menschen, die ein besseres Leben suchten. 70 Prozent der Inselbewohner sind selbst Geflüchtete. »Auch wir waren arm und nicht willkommen. Es ist nicht nur eine Art etwas zurückzugeben«, sagt die 85-Jährige: »Wir Inselbewohner können auch gar nicht anders, als zu helfen«.
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.