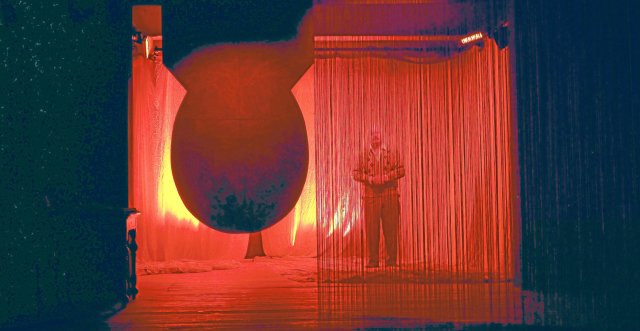Keine Besserung in Sicht
Der größte Maßregelvollzug Deutschlands steht in Berlin. Er wächst stetig an, und mit ihm wachsen die Probleme
Berlin im November. Die fürsorgerische Hilfskraft einer Notübernachtung ist als nächste Zeugin geladen. Dass diese Nacht unspektakulär gewesen sei, sagt sie. Und schaut nach rechts, zum Beschuldigten. Er habe geklingelt, sie habe ihm durch die Gegensprechanlage gesagt, dass das Haus voll belegt sei. Dass er um diese Zeit auch nicht mehr aufgenommen werden könne. Hamin E., der Angeklagte, greift zu einem Plastikbecher an seinen Füßen und trinkt einen großen Schluck. Der Richter fragt: »Hier steht, Sie haben gesagt, es sei zwar noch etwas frei, aber Sie erwarten noch eine Familie?« Ja, sagt die Frau. Stimmt. Hamin E. lässt seinen Oberkörper auf die Anklagebank sinken. Der Richter sagt: »nicht schon wieder« und unterbricht den Prozess gegen den sogenannten U-Bahn-Schubser, jenen Mann, der im Januar eine ihm unbekannte Frau vor einen einfahrenden Zug gestoßen und damit getötet hat, kurz nachdem er in der Notunterkunft abgewiesen worden war.
Ein Prozess wie dieser kann zäh werden. Es ist ein sogenanntes Unterbringungsverfahren, von dem es in Berlin viele gibt, allein in jener Woche beginnen vier neue Prozesse. Es ist gekennzeichnet durch erzwungene Pausen, den Zusammenbruch der Täter und das Weinen der Angehörigen, nicht selten, wie in diesem Fall, wird auch die Öffentlichkeit ausgeschlossen. Es geht darum festzustellen, ob jemand, der eine erhebliche Straftat begangen hat, psychisch krank und somit nach Paragraf 63 Strafgesetzbuch nicht schuldfähig ist.
Im Treppenhaus des Gerichts fragt ein älterer Mann: »Ist der verrückt oder tut der nur so?« Die Frau neben ihm sagt: »Der tut nur so.« Ja, sagt der Mann, und dass er das auch denke. Dass die alle in den Maßregelvollzug wollen. »Da stehen Blumenkübel im Hof.«
Der Ort, an dem Blumenkübel im Hof stehen sollen, hat die Adresse Olbendorfer Weg 70. Es gibt jedoch weder einen Weg noch ein Haus mit einer Hausnummer. Am Eingang des Geländes zur ehemaligen Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik in Reinickendorf steht vielmehr ein leeres Pförtnerhäuschen, ein Grenzbaum sperrt die asphaltierte Straße, die in einen Wald hinein zu führen scheint. Die Blätter sind bereits in großen Mengen von den Bäumen gefallen, es riecht nach Erde. Ein großer Lageplan weist eine kleine Stadt aus. Hier liegt das Krankenhaus des Maßregelvollzugs, kurz KMV, das genau das sein soll: eine Heilstätte, kein Gefängnis. Es umfasst dreizehn Häuser, noch einmal so viele gehören der Krankenhausverwaltung des Konzerns Vivantes, zudem nutzt das Landesamt für Gesundheit und Soziales seit 2013 zwei Gebäude als Notunterkunft für Geflüchtete.
Wer mit Andreas Kintzel, dem Geschäftsleiter des KMV, sprechen will, muss durch eine Tür gehen, die mit Metallgittern und Plastik verstärkt ist, über der Stacheldraht hängt, und seinen Personalausweis beim Pförtner abgeben. Im Hof stehen keine Blumenkübel, stattdessen ein Plastikstuhl. Ein Zaun zerteilt das Areal, zwei Wächter reden durch den Maschendraht miteinander. »Eigentlich wollten wir innerhalb des Geländes keine Zäune haben«, sagt Kintzel zur Begrüßung. Wegen des »Belegungsdrucks« seien hier jedoch neben den psychisch Kranken auch diejenigen untergebracht, die nach Paragraf 64 verurteilt worden sind - und aufgrund einer Suchterkrankung als nicht schuldfähig gelten. Eigentlich müssten die Gruppen getrennt voneinander untergebracht werden, sagt Kintzel, auch, weil »die 64er die 63er als Drogenkuriere missbrauchen«. Deshalb also der Zaun.
Den »Belegungsdruck« kann er mit Zahlen belegen. Der Berliner Maßregelvollzug ist der größte bundesweit. Es gibt hier 432 Betten, zusammen mit der Suchtkranken-Station im Stadtteil Buch sind es 523, mit den offenen Einrichtungen sogar fast 700. Der nächstgrößere Maßregelvollzug sei das westfälische Eickelborn mit 360 Betten, die meisten Flächenstaaten hätten durchschnittlich 120 Betten. Als der Berliner Standort vor 20 Jahren gegründet wurde, startete er mit 303 Betten.
Der neueste Zugang: die Jugendforensik. Haus 4 ist auf dem Lageplan noch rot eingefärbt, zu Vivantes gehörig, vor vier Jahren übernahm das KMV die Abteilung. Ein Jahr zuvor war der Psychiater Stefan Hütter hierher gekommen, der leitende Arzt arbeitete vorher in Brandenburg. Er sagt: »Die Familien sind hier im Schnitt zerrütteter.« Und: »Die Menschen sind ein bisschen kränker.« Ein Grund für den Zuwachs?
Hütter verneint. Zum einen gebe es einen Paradigmenwechsel hin zu mehr Sicherheit. Bis vor kurzem habe es um eine Anstalt nahe Dresden nicht einmal einen Zaun gegeben. Zum anderen sei da das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das 2011 die Zwangsmedikation erschwert hat. Dies habe dazu geführt, dass es »Unbehandelte« gebe, »die nicht hierher hätten kommen müssen«. Zum dritten sei da der Kostendruck an Krankenhäusern. Während früher Patienten mit paranoider Schizophrenie - diese Diagnose teilen 70 Prozent der Menschen im KMV - zwei bis drei Monate in den psychosomatischen Stationen verweilt hätten, seien es nun vier bis sechs Wochen. »So entstehen Drehtürpatienten«, sagt Hütter.
Ein solcher Drehtürpatient scheint auch der »U-Bahn-Schubser« Hamin E. gewesen zu sein. Der 1987 in Hamburg geborene Sohn iranischer Flüchtlinge ist seit seinem elften Lebensjahr psychisch auffällig. Als 14-Jähriger wird er zu einer Jugendstrafe von zwei Jahren und neun Monaten verurteilt. Erst viel später stellen Ärzte eine Psychose fest. Seine Odyssee durch die Psychiatrie beginnt 2002, unterbrochen von Straftaten wie Diebstahl, Raub und Körperverletzung. Er wird 13 Mal eingewiesen, bekommt elf psychiatrische Gutachten. Zuletzt begab sich der Wohnungslose am 1. Januar dieses Jahres in stationäre Behandlung. Dort wurde er am 18. Januar entlassen - wegen »fehlender akuter Eigen- und Fremdgefährdung«.
Kaum eine Krankengeschichte im KMV endet jedoch so dramatisch - mit einem Mord. Auch Sexualstraftäter sind hier kaum anzutreffen: Hütter schätzt ihre Zahl unter den Patienten auf fünf bis sechs Prozent. Zwar muss für eine Einweisung eine »erhebliche Straftat« vorliegen, wie eine schwere Körperverletzung. Doch die meisten sind hier wegen weitaus geringerer Straftaten.
So auch Jan Krämer, der im wirklichen Leben anders heißt. Jenseits des Stacheldrahts, draußen auf der asphaltierten Straße, geht der bärtige 25-Jährige mit einem Pappbecher Kaffee in der Hand. Ob er ein Patient sei? Ja, sagt er. Vor sechs Jahren sei er eingewiesen worden, seit einem Jahr lebe er »extern«, in einem Wohnprojekt in Wedding. Einmal in der Woche muss er sich im KMV vorstellen.
Wenn er über seine Tat spricht, sagt er nicht »ich«, sondern »man«. »Man hatte eine Migrantenfamilie im Rücken, bei der man Schulden hatte«, zum Beispiel. Oder: »Man hatte die Waffe im Hosenbund.« Bei seinem zweiten Banküberfall wurde Krämer festgenommen, »glücklicherweise«, sagt er, sonst wäre er da nie rausgekommen. Da, das heißt: aus der Beschaffungskriminalität wegen Kokainsucht. Der Gutachter diagnostizierte bei ihm Borderline und Polytoxikomanie. »Das bedeutet: Man schiebt sich alles rein, was ballert«, sagt Krämer.
Wie auch Hamin E. hat Krämer früh gemerkt, dass nicht alles in Ordnung war. Selbstverletzungen, Gefühlsausbrüche. »Eher passiv-aggressiv, nie gegen andere Personen.« Er suchte eine Tagesklinik auf, die gesagt habe, er müsse zunächst einen Entzug machen. Er wies sich ins Urban-Krankenhaus ein, doch weil er als nicht selbstmordgefährdet eingestuft wurde, sei er bald entlassen worden. Dann kam er zur Treberhilfe. »Das war genau die Zeit von Maserati-Harry«, sagt Krämer und lacht rau. 2010 war bekannt geworden, dass der Geschäftsführer Harald Ehlert einen Maserati als Dienstwagen fuhr, später wurde dem Verein die Gemeinnützigkeit aberkannt. »Da war damals schon relativ viel Wirrwarr«, sagt Krämer. Und: »Die haben gar nichts mit mir gemacht.«
Nun hat er es fast geschafft, im Januar soll er entlassen werden, das Gutachten hat er bereits in der Tasche. Ziel des Maßregelvollzugs ist die Sicherung und Besserung des Patienten, so will es das Gesetz. »Besserung muss man erproben«, sagt Hütter. Das bedeutet begleiteter Ausgang und letztendlich auch eine offene Wohnform. Auf dem Weg dahin braucht es Pfleger, die die Patienten begleiten. Und genau hier liegt eins der vielen Probleme des wachsenden Vollzugs. Auf der Internetseite des KMVs sind »mehrere« Pflegerstellen ausgeschrieben, »besetzbar ab sofort«. Das ist stark untertrieben. Von 429 Stellen sind nur 370 besetzt. An der Bezahlung liege das nicht, sagt Kintzel: Pfleger bekommen hier den guten Tarif des Universitätskrankenhauses Charité - nicht den der Amtsärzte. Der Geschäftsleiter gibt dem bundesweiten Pflegenotstand die Schuld, aber auch dem Umstand, dass die Pfleger selbst bei gutem Lohn keine bezahlbaren Wohnungen finden. Auch habe die Psychiatrie nur einen »verschwindend geringen Anteil« an der Ausbildung, das KMV lege darauf aber Wert.
Patient Krämer hat seine eigene Theorie, warum die Pfleger ausbleiben. »Der Arbeitsplatz ist schrott«, sagt er. Das liege an den Hierarchien und daran, dass »alle Möglichkeit genommen wird, eine Beziehung zu den Patienten aufzubauen«. Bei Vivantes hätten die Pfleger die Patienten noch geduzt. Nun gebe Anweisungen von oben, alte Teams seien auseinandergerissen worden. Konflikte würden gewaltsam gelöst: »Einmal in der Wochen holen die das SEK.« Oft kämen die Patienten dann in die Isolationszelle. »In meiner Zeit habe ich vielleicht viermal erlebt, dass das Fixieren gut war«, sagt Krämer. »Und ich habe das ein- bis dreimal die Woche erlebt.«
Der Pflegenotstand scheint manchmal sogar lebensbedrohlich zu sein. Krämer krempelt seine Ärmel hoch und zeigt seine vernarbten Handgelenke. »Als ich mir 2012 die Pulsadern aufgeschnitten habe, ist das einem Patienten aufgefallen, keinem Pfleger.« Er sagt auch: »Leute erhängen sich. Die sterben nicht an Genickbruch, den Knoten kriegt da niemand hin, sondern an Strangulation, das dauert lange.« Tatsächlich sind die Zahlen alarmierend: Während es 2010 keinen Suizid und nur einen Versuch gab, gab es 2015 eine Selbsttötung und sechs Versuche.
Und noch ein Problem gibt es: Wenn Krämer im Januar entlassen wird, heißt das nicht, dass er tatsächlich anderswo wohnt. Sozialarbeiter suchten bis zu neun Monate nach einer Wohnung, sagt Hütter, die Warteliste werde länger. »Ein Rückstau bis in den Maßregelvollzug« sei entstanden, »ein Riesenskandal«. Richter hätten kommuniziert, im Zweifel auch in die Obdachlosigkeit zu entlassen. Soweit wolle es das KMV nicht kommen lassen. Die Konsequenz: »Die Menschen werden aus dem Paragrafen entlassen, nicht aus dem Heim.«
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.