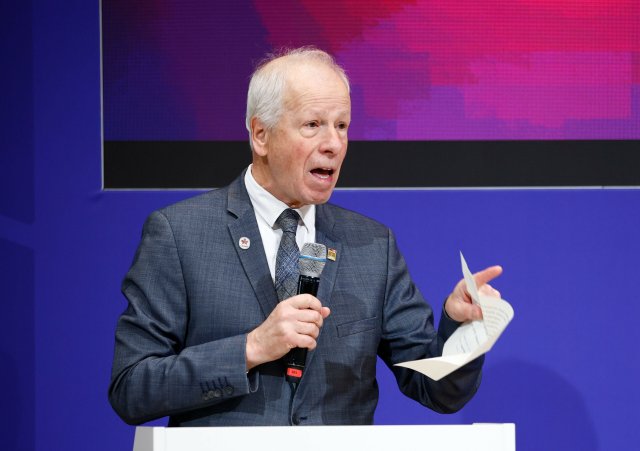Feste Stellen nur noch in Kernbereichen
»Finanzialisierung« der Arbeit nimmt zu, doch Löhne und Jobquote sprechen für eine lebhafte Tarifrunde
Nicht allein die Industrieproduktion unterliegt immer stärker der Logik der Finanzmärkte. Das bekommen die Beschäftigten zu spüren, wie eine aktuelle Fallstudie zeigt. Der Wirtschaftssoziologe Hajo Holst von der Universität Osnabrück hat untersucht, wie sich die »Finanzialisierung«, also die Steuerung von Unternehmen nach kapitalmarktorientierten Kennzahlen, auf die Forschungs- und Entwicklungsabteilung eines deutschen Autoherstellers auswirkt. Die Folgen seien »weitreichender als bislang angenommen«.
Dies zeige sich vor allem bei der Personalplanung: Stellenbesetzungen werden mittlerweile als »Investitionsentscheidungen« angesehen - selbst unter den Beschäftigten. Eine unbefristete Stelle gelte als »Investition für 30 Jahre« und müsse genauso lange Erträge erwirtschaften. Eine feste Stelle komme daher nur noch für Arbeiten infrage, die zu den Kernkompetenzen des Unternehmens zählen. Der Forscher wertet dies als Beleg für die »Tiefenwirkung« der Finanzialisierung, die sich in einem veränderten Blick auf Arbeit niederschlägt.
Verschärfend komme hinzu, dass Unternehmensleitungen eine Obergrenze für das Personal, den »Headcount«, festlegen. In der Praxis führt dies dazu, dass es kaum neue Festanstellungen gibt. Über die bestehenden Ressourcen hinausgehende Arbeiten müssen meist über Werk- und Dienstverträge eingekauft werden. Und die sind im Regelfall preiswerter, weil schlechter bezahlt.
Dennoch sind die Arbeitskosten in Deutschland im EU-Vergleich relativ hoch. »Arbeitgeber« in Industrie und wirtschaftsnahen Dienstleistungen zahlten 2016 im Schnitt 33,40 Euro je Arbeitsstunde. Davon waren ein Fünftel Lohnnebenkosten, vier Fünftel der Bruttolohn. Laut Statistischem Bundesamt lag das Arbeitskostenniveau in Deutschland damit EU-weit auf Rang sieben. Im Vergleich zum Nachbarland Frankreich (36,30 Euro), dem wichtigsten Handelspartner nach China, waren es aber knapp acht Prozent weniger. Dänemark hat mit 43,40 Euro die höchsten Arbeitskosten je geleisteter Stunde, Bulgarien mit 4,40 Euro die niedrigsten.
Der Stundensatz von 33,40 Euro sollte aber nicht über die interne Kluft hinwegtäuschen. So werden »private« Dienstleistungen vom Bäcker bis zur Putzfrau weit schlechter bezahlt. Und »die da oben« verdienen unanständig viel. Das meint jedenfalls die Präsidentin des Bundesarbeitsgerichts, Ingrid Schmidt: Das 148-Fache des Gehalts eines Facharbeiters - »so viel kann keine Arbeit wert sein«.
Dabei blieb die Lohnquote zuletzt ziemlich stabil, je nach Berechnungsmethode, bei etwa 68 Prozent. Diese Quote, die den Anteil der Arbeitnehmerentgelte am Volkseinkommen angibt und als zentraler sozialer Indikator gilt, war bis vor einem Jahrzehnt ohnehin höher. Vor allem aber verteilen sich heute die 68 Prozent auf weit mehr Köpfe als früher. Denn die Zahl der abhängig Beschäftigten stieg in Deutschland seit 2010 um über 2 Millionen auf 39 Millionen.
Auch in Westeuropa erholen sich die Arbeitsmärkte von der Finanzkrise - »langsam, aber stetig«, wie das gewerkschaftsnahe Forschungsinstitut IMK schreibt. Eine Folge der günstigen Konjunktur in vielen EU-Ländern, zu der auch die Niedrigzinsen der Europäischen Zentralbank beitragen. Die saisonbereinigte Erwerbslosenquote des Euroraums lag im Januar bei 9,6 Prozent, immerhin der niedrigste Stand seit acht Jahren. Selbst in den Krisenländern Griechenland, Portugal und Spanien nimmt die Arbeitslosigkeit ab.
Schneller als der Abbau der Arbeitslosigkeit ging zuletzt der Aufbau der Beschäftigung vonstatten, was ja nicht das Gleiche ist. Immer mehr Menschen finden Arbeit, gleichzeitig aber ist die Zahl der Arbeitsuchenden gewachsen, darunter viele Flüchtlinge. Dennoch ist der Anteil der Erwerbstätigen in Deutschland im europäischen Vergleich hoch: Vier von fünf der 20- bis 64-Jährigen arbeiten. Da können nur Schweden, Norwegen und die Schweiz mithalten. Die Bedingungen für die kommenden Tarifrunden bewerten Gewerkschafter daher als günstig.
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.