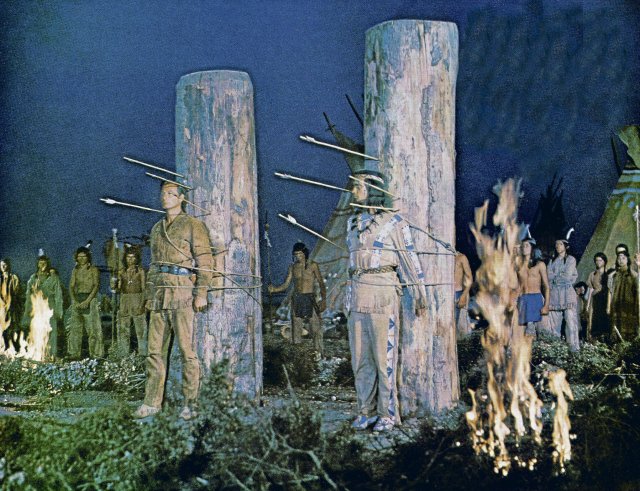Eine Fundgrube
Erstmals auf Deutsch: Vladimir Nabokovs Briefe an seine Frau Véra
Der Vater von Vladimir Nabokov (1899 - 1977), ein liberaler Politiker und Journalist, wurde 1922 in Berlin von russischen Rechtsextremisten ermordet. Der Sohn, der in Cambridge Naturwissenschaften sowie russische und französische Literatur studiert hatte, übersiedelte im gleichen Jahr nach Berlin, wo er als Übersetzer, Privatlehrer und Gelegenheitsschauspieler arbeitete und unter dem Pseudonym W. Sirin erste Prosawerke herausgab. Mit dem Roman »Maschenka« begann 1926 seine literarische Karriere, die mit Werken wie »Die Gabe«, »Einladung zur Enthauptung«, »Lolita« und »Ada oder Das Verlangen« (die letzten beiden bereits in englischer Sprache geschrieben) neue Höhepunkte fand.
1923 lernte Nabokov auf einem Berliner Wohltätigkeitsball der Exilrussen die aus Sankt Petersburg stammende attraktive und literaturbegeisterte Jüdin Véra Slonim kennen, die er 1925 heiratete. Véra war seine Muse, Sekretärin und ideale Leserin, sie tippte seine Manuskripte ab, chauffierte ihn, erledigte seine Korrespondenz, verhandelte mit seinen Verlegern und unterstützte ihn bei der Komplettierung seiner Schmetterlingssammlung. Sie floh mit ihm 1937 nach Prag und anschließend nach Frankreich, folgte ihm 1940 in die USA, teilte ab 1961 mit ihm die Hotelsuite im Schweizer Montreux und überlebte ihren Mann um fast vierzehn Jahre. 1951 erschien Nabokovs Autobiographie »Andere Ufer« und danach jedes weitere Buch von ihm mit der Widmung »Für Véra«. Véras Briefe an ihn sind nicht erhalten, sie wurden vermutlich von ihr vernichtet.
Nabokovs Briefe an Véra von 1923 bis 1976 zeugen von einer innigen Beziehung der beiden. Véra sei der einzige Mensch, mit dem er über alles reden könne, er gehöre zu ihr - »mit all meinen Erinnerungen, Gedichten, Gefühlswallungen, inneren Wirbelwinden«, schreibt er ihr. Er schwärmt: »Wir beide sind etwas ganz Besonderes, solche Wunder, wie wir sie kennen, kennt niemand, und niemand liebt so wie wir.« In jedem Brief sucht er nach einer neuen Anrede, einem ungewöhnlichen Kosewort, nennt Véra »meine Sonne«, »meine Freude«, »Puschel«, »Springmaus« oder »Mückilein«.
In einem krassen stilistischen Kontrast dazu stehen Nabokovs penibel nüchterne Mitteilungen über Berliner Alltagsdinge. Da geht es um die ständigen Geldsorgen, die Bestandteile des täglichen Mittag- und Abendessens, Äußerungen über das Wetter, die Kleidung, das Tennisspielen, das Schwimmen und das Sonnenbaden im Grunewald.
In Nabokovs Briefen dominiert das Private. Dass der Autor sich im Deutschland der 1930er Jahre nicht wohlfühlte und Berlin nicht liebte, verraten nur wenige Zeilen. Eifrig versuchte er jedoch, sich in das literarische Leben im »russischen Berlin« einzubringen. Häufig besuchte er den Ladyshnikow-Verlag und lieh sich dort aktuelle Werke sowjetrussischer Autoren aus, um sie im Literaturzirkel von Vladimir Tatarinow, einem Mitarbeiter der Tageszeitung »Rul«, vorzustellen. Seine Urteile zeugen von einer antisowjetischen Grundeinstellung und einem selbstherrlichen Aristokratismus. Nabokov mokiert sich über die »Armseligkeit« der sowjetischen Belletristik. Gladkows »Zement« und Seifullinas »Wirineja« seien »trivial«, eine Erzählung von Soschtschenko »idiotisch«, Leonows »Dachse« »ein bisschen besser als der ganze übrige Plunder«. Auch zu den anderen, meist in Frankreich lebenden Emigranten unterhielt Nabokov ein gespanntes Verhältnis. Er lobt »eine hervorragende Erzählung« von Bunin, vergleicht den Autor jedoch im gleichen Atemzug mit »einer ausgezehrten alten Schildkröte«. Die Mereshkowskis sind in seinen Augen »ein widerwärtiges Ehepaar«, Teffi ist »eine hexenhafte Alte«.
Nabokovs Briefe an seine Frau Véra, Zeugnisse einer lebenslangen Liebe und intellektuellen Leidenschaft, werden hier zum ersten Mal auf Deutsch publiziert. Auch dieser letzte Band der opulent ausgestatteten Gesammelten Werke des russisch-amerikanischen Schriftstellers, weltweit die vollständigste und genaueste Edition, ist eine Fundgrube für jeden Literaturfreund.
Vladimir Nabokov: Briefe an Véra. Hg. v. Brian Boyd u. Olga Voronina. Deutsch von Ludger Tolksdorf. Rowohlt, 1148 S., geb., 40 €.

Das »nd« bleibt gefährdet
Mit deiner Hilfe hat sich das »nd« zukunftsfähig aufgestellt. Dafür sagen wir danke. Und trotzdem haben wir schlechte Nachrichten. In Zeiten wie diesen bleibt eine linke Zeitung wie unsere gefährdet. Auch wenn die wirtschaftliche Entwicklung nach oben zeigt, besteht eine niedrige, sechsstellige Lücke zum Jahresende. Dein Beitrag ermöglicht uns zu recherchieren, zu schreiben und zu publizieren. Zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit deiner Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Sei Teil der solidarischen Finanzierung und unterstütze das »nd« mit einem Beitrag deiner Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.