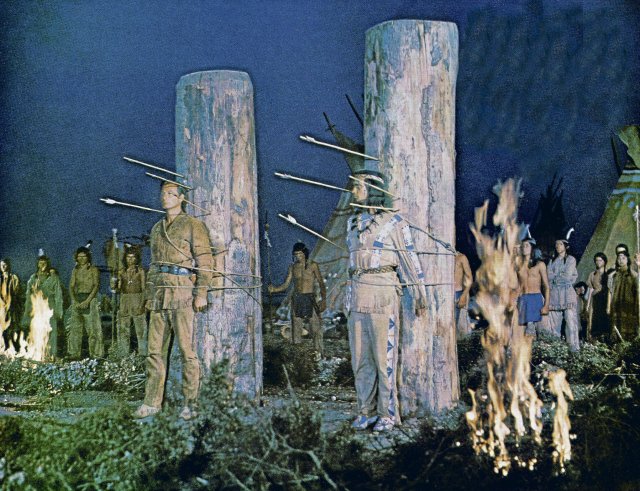Komm nach Hause, Margie
Eleanor Brown erzählt, was eine junge Amerikanerin von ihrer toten Großmutter lernt
Madeleine kommt nicht aus Paris, sondern aus Magnolia, USA. Warum hat sie als kleines Mädchen, hineingeboren in eine typisch amerikanische Familie in einer texanischen Kleinstadt, diesen französischen Vornamen bekommen? Hätte es je etwas Frankophiles in ihrem Wesen gegeben, so wäre die Sehnsucht zu nennen, Kunst zu studieren und Künstlerin zu werden; die Lust, das Essen zu genießen; die ungebändigte Haarpracht oder die wenig ausgeprägte Versuchung, ordentlich zu sein. Und das absolute Desinteresse an den Heiratsplänen ihrer Altersgenossinnen und deren Hobbys. Sie verschwendeten sich an Partys, Diäten und Bälle - einzig zu dem Zweck, später eine gute Partie zu sein. Gut geschminkt und im rosa Twinset, bereiteten sie sich auf ein Leben als Arztgattin, Mutter oder Ehefrau vor.
Währenddessen quetschte Madeleine im Keller Ölfarbe aus der Tube und malte in einer bekleckerten Latzhose ihre Angst vor der Zukunft auf die Leinwand. Ganz zu Recht, denn sie würde den Absichten ihrer Mutter nicht lange trotzen. Genau dieses Szenarium, dem bereits sie selbst und vorher schon ihre eigene Mutter gefolgt waren, hatte sie auch für ihre einzige Tochter vorgesehen.
Eleanor Brown gelingt es fabelhaft, Madeleines Wandlung von einer Halbwüchsigen mit Träumen hin zu einer unsicheren, verängstigten Frau zu beschreiben, die sich eines Tages selbst fremd ist. So viele kleine Kompromisse hat sie gemacht und winzige Entscheidungen getroffen, die sich schließlich aber zu etwas Größerem addierten, das nicht mehr viel mit der zeichenwütigen Madeleine aus der Highschool zu tun hatte. Am Ende glich ihr Leben »den Porzellanfiguren aus der Vitrine meiner Mutter: glatt und überladen, dabei zerbrechlich und hohl. Nur für Ausstellungszwecke. Bitte nicht berühren.«
Da ist sie schon, die erste Allegorie Brownscher Prägung - so selbstverständlich, als wäre sie der Autorin gerade eingefallen, weil sie ihre Hauptfigur just in dem Augenblick neben der Vitrine im Hause der Mutter stehen sieht. Es folgen viele davon, und sie machen die Sprache des Buches besonders, holen Wärme aus den Buchstaben und stellen Menschen und Dinge in einen Zusammenhang, dem die Leserin, der Leser Verständnis und Erkenntnis verdanken.
Madeleine hätte Phillip nicht heiraten sollen. Sie wusste es, als ihr in der Kirche der rote Teppich zum Altar wie eine obszöne, rote Zunge vorkam und als sie auf der Hochzeitsfeier ihren eigenen Platz verlor. Auf den Fotos steht sie ohne Lächeln, dafür aber mit weit aufgerissenen, starren Augen. Es war der Gesichtsausdruck einer Frau, die etwas Schreckliches angerichtet hatte und nicht wusste, wie sie da wieder herauskommen sollte, weiß sie später.
Parallel zu Madeleines Geschichte erzählt die US-amerikanische Erfolgsautorin in ihrem zweiten Roman - ihr Debüt »Die Shakespeare-Schwestern« war ein Bestseller - die von Margie, die zwei Generationen vor Madeleine lebte. Sie war ebenfalls Amerikanerin. Unter dem Druck ihrer Familie, ein Leben nach den gesellschaftlichen Konventionen zu führen, zerbrach sie fast.
Durch Zufall gelingt es ihr in den 1920er Jahren, nach Paris zu kommen. Sie verliebt sich in die Stadt und in Sébastien. Enttäuschung durch ihre Liebe, schwere Krankheit und Mittellosigkeit führen sie allerdings wieder auf den Pfad der amerikanischen Tugend zurück. »Komm nach Hause, Margie«, telegrafieren ihre Eltern. Das ist alles andere als nett gemeint. Es ist ein Befehl. Sie muss Paris den Rücken kehren, geht eine Ehe ein, bekommt eine Tochter und achtet darauf, dass sich diese nicht genau solche Extravaganzen leistet wie sie selbst.
Diese Tochter ist Madeleines Mutter. Sie hat die Tagebücher ihrer eigenen Mutter gelesen und sie vermutlich vor lauter Schreck über deren Eskapaden gleich wieder vergessen. Jedenfalls hat sie geschwiegen. Hat ihr Kind zur Hochzeit mit einem ungeliebten Mann gedrängt.
Auch als Madeleine die Tagebücher ihrer Großmutter findet und von deren freiem Geist zur längst überfälligen Trennung von Phillip ermutigt wird, bleibt eine Erklärung von Madeleines Mutter aus. Über diese Frau, immerhin ist sie die Tochter eines Franzosen, hätte man liebend gern noch mehr gelesen.
Eleanor Brown: Die Lichter von Paris. Roman. Aus dem Amerikanischen von Christel Dormagen und Christine Heinrich. Insel Verlag, 386 S., br., 14,95 €.

Das »nd« bleibt gefährdet
Mit deiner Hilfe hat sich das »nd« zukunftsfähig aufgestellt. Dafür sagen wir danke. Und trotzdem haben wir schlechte Nachrichten. In Zeiten wie diesen bleibt eine linke Zeitung wie unsere gefährdet. Auch wenn die wirtschaftliche Entwicklung nach oben zeigt, besteht eine niedrige, sechsstellige Lücke zum Jahresende. Dein Beitrag ermöglicht uns zu recherchieren, zu schreiben und zu publizieren. Zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit deiner Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Sei Teil der solidarischen Finanzierung und unterstütze das »nd« mit einem Beitrag deiner Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.