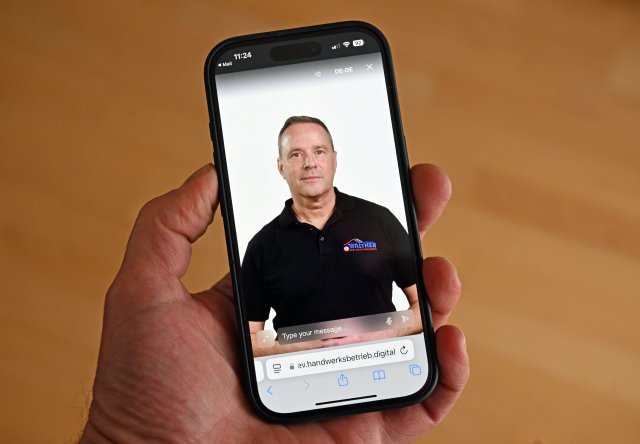- Wirtschaft und Umwelt
- Wiedereingliederung
Kaum Hilfe bei der Wiedereingliederung
Firmen haben trotz Corona weniger Interesse, dass Angestellten nach langer Krankheit geholfen wird
War man lange krank, fällt einem die Rückkehr an den Arbeitsplatz häufig schwer. Maßnahmen im Rahmen des betrieblichen Eingliederungsmanagements (BEM) sollen da helfen. Doch ausgerechnet in der Corona-Pandemie geht das Interesse der Unternehmen an solchen Maßnahmen offenbar zurück, wie die Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Linke-Bundestagsfraktion zeigt, die »nd.DerTag« vorliegt. Ließen sich im Jahr 2019 noch 7201 Firmen bei der Deutschen Rentenversicherung über Möglichkeiten des BEM beraten, so waren es vergangenes Jahr nur noch 4032. Auch im größeren Vergleich ist diese Zahl gering: Von 2017 bis 2020 ließen sich pro Jahr im Schnitt 5643 Unternehmen beraten.
»Gerade mit Blick auf die vielen schwer an Corona Erkrankten ist es ein Unding, dass sich viele Unternehmen um das betriebliche Eingliederungsmanagement drücken«, kommentiert die Sprecherin für Mitbestimmung und Arbeit der Linke-Bundestagsfraktion, Jutta Krellmann, die Zahlen. »Beschäftigte dürfen nicht verschlissen und entsorgt werden. Ihre Arbeitsfähigkeit muss erhalten bleiben.«
Das im Sozialgesetzbuch geregelte BEM ist neben dem sogenannten Hamburger Modell eine Möglichkeit, um länger kranke Angestellte und Schwerbehinderte wieder fit für den Arbeitsplatz zu machen. Es soll Angestellten offenstehen, die innerhalb eines Jahres länger als sechs Wochen ununterbrochen oder wiederholt arbeitsunfähig waren. Durch BEM-Maßnahmen, die zwischen dem Betroffenen, dem Chef und dem Betriebsrat abgesprochen werden, soll die aktuelle Arbeitsunfähigkeit möglichst überwunden, einer erneuten Arbeitsunfähigkeit vorgebeugt und der Arbeitsplatz erhalten werden.
Doch den wenigsten Angestellten, denen dies eigentlich zusteht, werden BEM-Maßnahmen angeboten. Laut einer Studie der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin und des Bundesinstituts für Berufsbildung traf dies zuletzt lediglich auf vier von zehn Angestellten zu. 60 Prozent der Berechtigten erhielten kein solches Angebot.
Dabei ist das BEM durchaus beliebt und effektiv. Rund 70 Prozent der potenziell berechtigten Personen nehmen etwaige Angebote an. Vor allem bei psychischen Erkrankungen war die Teilnahme daran hoch. Gleichzeitig konnten durch die Maßnahmen häufig krankheitsbedingte Kündigungen vermieden werden. Laut einer vom Bundesarbeitsministerium geförderten Studie des DGB-Bildungswerkes konnten in mehr als 90 Prozent der befragten Betriebe die BEM-Teilnehmenden zumindest überwiegend im Unternehmen gehalten werden. Die Chance auf Erhalt des Arbeitsplatzes ist dabei in Betrieben mit mehr als 500 Beschäftigten am größten (96,7 Prozent) und bei solchen mit bis zu 50 Beschäftigten am geringsten (86,4 Prozent). Häufig haben in größeren Betrieben Betriebsrat und Geschäftsführung eine Betriebsvereinbarung zum Thema BEM ausgehandelt.
Doch weil eben bei weitem nicht alle Beschäftigten ein Angebot bekommen, wie die Antwort auf die Kleine Anfrage zeigt, sieht Linke-Politikerin Krellmann die Bundesregierung in der Pflicht: »Sie muss fahrlässigen Arbeitgebern auf die Finger klopfen und dafür die Gesetze nachschärfen.« Dazu gehöre: Betriebs- und Personalräte sollten beim BEM zwingend mitentscheiden können. »Denn mehr Mitbestimmung ist der beste Schutz für Beschäftigte«, so Krellmann. Außerdem ist ihr zufolge ein individueller Rechtsanspruch nötig, den Betroffene auch einklagen können. »Für Arbeitgeber muss es ernsthafte Folgen haben, wenn sie ein BEM verweigern. Auch hier brauchen wir schärfere Regeln«, fordert Krellmann. Nötig seien auch weitere Reformen beim betrieblichen Eingliederungsmanagement.
Lesen Sie zum Tag der Pflege, wie Berliner Krankenhausbeschäftigte
mehr Lohn und bessere Arbeitsbedingungen fordern.
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.