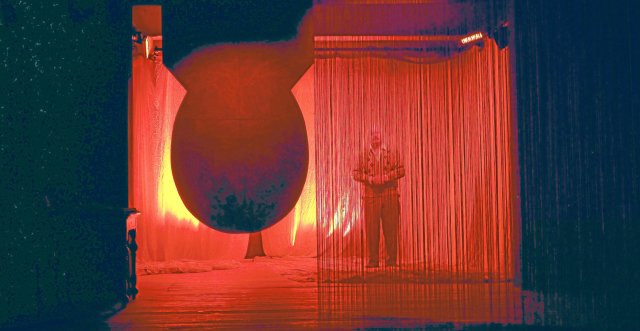- Berlin
- Klimakrise
Wetter ohne Maß und Mitte
Berlin und Brandenburg gehören zu den Hotspots der Klimakrise in Deutschland
Als Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz im vergangenen Monat vom Starkregen überflutet wurden, saß der Schock bei vielen Menschen tief. Die Klimakrise - das haben das Tief Bernd, aber auch schon die Hitzesommer seit 2018 deutlich gemacht - betrifft auch Deutschland. Wetterextreme wie anhaltende Starkregen und Hitzewellen werden zukünftig immer häufiger in vergleichbarer Intensität auch in Berlin und Brandenburg auftreten, sagt Peter Hoffmann, Wissenschaftler am Potsdam Institut für Klimafolgenforschung, der sich mit der Veränderung des Wetters in Europa im Kontext globaler klimatischer Veränderungen beschäftigt.
»Der Klimawandel begünstigt die längere Andauer von Wetterlagen, die normalerweise schnell von West nach Ost ziehen würden«, erklärt er im Gespräch mit »nd«. Grund sei, dass sich die Arktis schneller erwärme als der Rest der Erde. Das schwäche den Jetstream, ein globales Starkwindband, das eigentlich für den Ausgleich von Hoch- und Tiefdruckgebieten sorgt. Mit abnehmender Windgeschwindigkeit würden Hochs und Tiefs länger an einem Ort verbleiben. Die Folge: lang anhaltende Hitze- und Dürreperioden einerseits und tagelange Starkregen andererseits.
Dezentrales Regenwassermanagement
In Großstädten wie Berlin könne extremer Niederschlag zum Problem werden. »Je bebauter eine Stadt ist, desto schlechter kann Wasser abließen«, sagt Hoffmann. Kanalisationen seien nicht darauf ausgelegt. Deshalb warnt er davor, immer mehr Flächen für Neubauten zu versiegeln. Stattdessen sollte die Politik Altbaubestände und das Umland aufwerten, zum Beispiel durch eine verbesserte Infrastruktur, um die Metropolregion zu entlasten. Laut dem Berliner Senat kommt es eher darauf an, »wie gebaut wird und wie man mit dem Regenwasser umgeht«, sagt Jan Thomsen, Sprecher der Senatsumweltverwaltung, zu »nd«. »Das Land Berlin setzt auf ein dezentrales Regenwassermanagement. Für alle Neubauflächen werden Überflutungsnachweise gefordert, also der Beleg des Bauherrn, dass Regenwasser nicht in die Kanalisation abließt.« 2018 wurde zu diesem Zweck vom Land und den Berliner Wasserbetrieben eine Regenwasseragentur gegründet, die Investor*innen berät. Beispielhaft seien Regenwasser-Stauräume wie unter dem Mauerpark und Gründächer, die Niederschläge auffangen, wie in Adlershof.
Peter Hoffmann empfiehlt außerdem, im Fall von Überschwemmungen Parks als Überflutungsflächen auszuweisen. Ein Pilotprojekt zur Erprobung eines Notwasserweges werde laut Jan Thomsen zurzeit am Obersee in Lichtenberg erprobt.
Der Wechsel von Hitze und Starkregen belastet zugleich die Böden und somit die Landwirtschaft. In Brandenburg gab es im Hitzesommer 2018 Ernteausfälle von bis zu 80 Prozent, sagt Tino Erstling, Sprecher des Landesbauernverbands Brandenburg. Nach einer solchen Dürreperiode seien die Böden dann so ausgetrocknet, dass sie gar nicht so schnell wieder Wasser aufnehmen können. »Wenn es dann plötzlich intensiv regnet, fließt das Wasser einfach ab, in die Flüsse und ins Meer - das bringt der Natur gar nichts. Eigentlich müsste es häufiger, aber weniger auf einmal regnen,« sagt Forscher Peter Hoffmann. In Potsdam sei allerdings sowohl im Juni als Juli der gesamte Monatsniederschlag an einem einzigen Tag gefallen.
Die Landwirtschaft sei daher auf Wasserregulierung angewiesen, zum Beispiel durch Wehre in Flüssen oder Gräben, die das Wasser in Trockenperioden aufhalten. »Die verschleißen aber zunehmend. Die Politik sollte deutlich mehr investieren, um diese Anlagen zu pflegen«, fordert Tino Erstling. Eine weitere Möglichkeit seien Behälter, die Wasser speichern. Vorreiter dafür sei Israel, Pilotprojekte gebe es in Bayern, in Brandenburg jedoch noch nicht. »Was wir bereits tun, ist in Trockenzeiten weniger zu pflügen, da dabei Wasser verdunstet«, erklärt Erstling. Außerdem würden die Landwirt*innen nun vermehrt tief wurzelnde Pflanzen wie Luzerne und Steinkleie anbauen, die einerseits den Wasserhaushalt der Böden unterstützen und andererseits eiweißreiches Futter für Nutztiere darstellen. »Aber ohne Wasser geht es nicht, denn Wasser ist Leben«, sagt Erstling.
Erwärmung um zwei Grad unvermeidlich
Berlin und Brandenburg gehören in Deutschland, neben dem Südwesten, im wahrsten Sinne des Wortes zu den »Hotspots« der globalen Erwärmung, so Klimaexperte Peter Hoffmann. Seit den 1960er bis 1990er Jahren sei Berlins Jahresmitteltemperatur von neun auf zehn Grad gestiegen. Die Anzahl der Hitzetage pro Jahr habe sich beinahe auf 13 verdoppelt. »In den letzten Jahren hatten wir schon 20 Hitzetage. Das zeigt, wohin der Weg führt.« Zwischen 2030 und 2060 werde, je nach Klimamodell, mit 16 oder bis zu 20 Hitzetagen gerechnet. Diese Entwicklung lasse sich wegen der Versäumnisse im Klimaschutz der letzten Jahre kaum noch vermeiden. Jetzt sei entscheidend, den Temperaturanstieg der nächsten 50 bis 100 Jahre zu stoppen, vor allem durch die Energiewende.
»Wir vergleichen Szenarien einer zwei Grad wärmeren Welt, die beinhalten, dass wir jetzt aus der Kohle aussteigen, mit Szenarien einer vier Grad wärmeren Welt, in denen das nicht passiert. Die EU muss nun voranschreiten«, so der Appell des Klimaforschers. Bei einer Erwärmung um vier Grad würde das Berliner Klima zwischen 2070 und 2100 dem gleichen, das heute in Genua herrscht. Gegen Hitze setzt der Berliner Senat auf Grünanlagen, Freiräume und Gewässer, die die Stadt abkühlen sollen. Der Senat habe daher mehr als 12 000 neue Stadtbäume pflanzen lassen und eine Charta für das Berliner Stadtgrün verabschiedet, sagt Jan Thomsen.
Alternative Modelle im Städtebau, bei der Bewirtschaftung der Böden, aber auch im Verkehr seien vor allem mit Blick auf die nachfolgenden Generationen von existenzieller Bedeutung, betont Peter Hoffmann. »Bei einer vier Grad wärmeren Welt werden wir an die planetaren Grenzen stoßen.«
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.