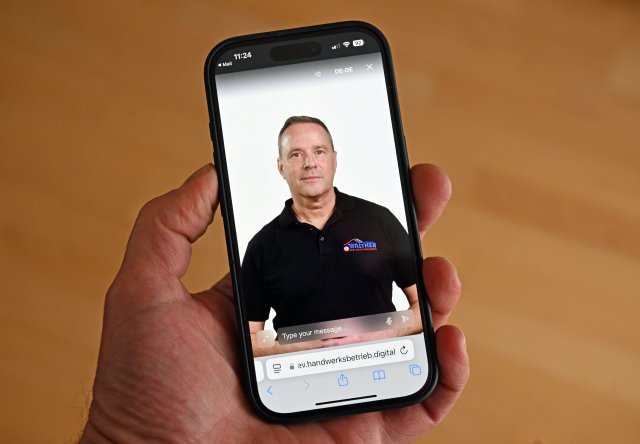- Wirtschaft und Umwelt
- Das Ende der Plastiktüte
Na dann mal tschüss ...
Plastiktüten sollen weiter reduziert werden
Es dauert bis zu 400 Jahre, bis eine Plastiktüte in ihre Bestandteile zersetzt wird, genutzt wird sie im Durchschnitt 20 Minuten, rechnen Umweltverbände vor. Ein Produkt der Wegwerfgesellschaft also und deshalb ist es durchaus passend in Zeiten veränderten Konsums, die Plastiktüte wieder zu ersetzen.
Seit Januar dürfen an den Ladenkassen in Deutschland keine Einkaufstüten aus Plastik mehr angeboten werden. Fast. Verboten sind nach einem Vorschlag der ehemaligen Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) von 2019 sogenannte leichte Kunststofftragetaschen mit einer Wandstärke zwischen 15 und 50 Mikrometer - das sind die Standardtüten, die es bis zur freiwilligen Selbstverpflichtung des Handels umsonst gab. Früher ungefragt mit aufs Warenband gelegt, kosteten sie seit 2016 einige Cents. Ausgenommen vom Verbot sind besonders stabile Mehrwegtüten sowie die dünnen Plastikbeutel, die man etwa am Obst- und Gemüsestand findet. Nach der Selbstverpflichtung des Handels beschloss der Bundestag im November 2020 das Verbot.
Deutschland setzt damit eine geänderte Richtlinie der Europäischen Union weiter um. Demnach ist es den Mitgliedstaaten überlassen, wie sie Plastiktüten reduzieren - Hauptsache sie werden weniger. Der Pro-Kopf-Verbrauch soll bis 2025 überall auf 40 Stück im Jahr sinken. Die EU-Mitgliedsstaaten setzten in den vergangenen Jahren dementsprechend auf unterschiedliche Instrumente wie Steuern und Abgaben in Irland, Verbote bestimmter Tüten in Italien und Frankreich oder Selbstverpflichtungen mit dem Handel wie in Großbritannien und Deutschland. In vielen Ländern außerhalb der EU sind Plastiktüten zum Teil schon länger verboten.
»Die Plastiktüte war eine Reaktion auf das Konsumverhalten«, hat der Historiker Heinz Schmidt-Bachem in einem Interview einmal gesagt. Der Plastiktütenforscher galt bis zu seinem Tod 2011 als unangefochtener Experte für die bunten Einkaufshilfen: Er erforschte ihre Geschichte, legte eine riesige Sammlung an und veröffentlichte eine Dissertation zu »Tüten, Beutel, Tragetaschen«.
In der Bundesrepublik, so hat der in Schwedt (Oder) geborene Tütenexperte recherchiert, trägt das erste technisch verwertbare Patent für eine »Plastiktragetasche« das Datum 1. November 1960. Zwischen 1946 und 1953 hatte man Erfahrungen mit vollsynthetischen Kunststoffen wie Polyethylen gesammelt - hieraus werden Plastiktragetaschen fast ausschließlich hergestellt. 1961 gab das Kaufhaus Horten in Neuss die ersten Plastiktüten aus. Die Premierenauflage von 80 000 war schnell weg. Den »Hemdchentüten« - die Träger sehen wie die eines Unterhemds aus - folgte 1965 die bis heute hergestellte Reiterbandtragetasche.
Schmidt-Bachem beschreibt die Auswirkungen der traggriffverstärkten Plastiktüte auf das Kaufverhalten der Kund*innen - insbesondere seit der Einführung von Selbstbedienungsmärkten, ohne die sich die Plastiktüte »niemals hätte durchsetzen können«. So belegt eine Studie aus den 1970er Jahren, dass die Kund*innen pro Plastiktüte für durchschnittlich 21 Prozent mehr Warenwert einkauften.
In der DDR dagegen war die Plastetüte kein Wegwerfprodukt. Zwar gab es seit 1958 fast alles aus Plastik: Föhne, Gießkannen, Ventilatoren, Eierbecher, Vasen ... An den Kassen bekam man dagegen keinen Plastebeutel in die Hand gedrückt - die wurden nur für bestimmte Anlässe produziert wie Messen, Veranstaltungen oder Firmenjubiläen. Sie waren aufwendig gestaltet und haltbar, weil das Material dicker war und weil es zum Tragen fast immer einen Steggriff aus stabilem Kunststoff gab. Nicht selten entwarfen Künstler*innen farbenprächtige Motive.
In Westdeutschland stand die Plastiktüte bereits gut zehn Jahre nach dem Start zur Debatte: Jute statt Plastik hieß es in den 1970er-Jahren. Durchsetzen konnte sich der hellbraune Beutel nicht. Denn um ökologisch sinnvoll zu sein, müssen Stoffbeutel entweder aus Recyclingmaterial stammen oder ihre Grundstoffe aus der ökologischen Landwirtschaft kommen. Beim klassischen Anbau von Baumwolle oder Flachs ist der Pestizid- und Wasserverbrauch immens hoch. Schätzungen des Naturschutzbundes gehen davon aus, dass ein Stoffbeutel bis zu 150 Male genutzt werden muss, um die schlechtere Ökobilanz auszugleichen.
Andere Alternativen sind ebenfalls umstritten. Papierbeutel, die nur einmal verwendet werden, sind es laut Bundesumweltamt (UBA) nicht. Zwar werden sie oftmals aus Recyclingpapier hergestellt, eher recycelt und landen seltener in der Umwelt, und wenn doch, kürzer, weil die Papierfasern schnell zerfallen. Dennoch, das BMU empfiehlt in erster Linie Mehrweg: Je häufiger benutzt, desto umweltfreundlicher. Demnach ist eine Mehrweg-Tragetasche aus Plastik bereits nach drei Nutzungen umweltfreundlicher als eine Einweg-Plastiktüte, denn letztere werden seltener aus recyceltem Material hergestellt.
Auch Kunststoffe aus Zucker, Kartoffeln oder Mais sind nicht unbedingt umweltfreundlicher. Sogenanntes Bioplastik lässt sich laut UBA kaum recyceln und »der Anbau von Pflanzen für die Kunststoffproduktion ist häufig mit verstärktem Pestizideinsatz verbunden und findet in Monokulturen statt«. Vor allem komme es darauf an, dass Taschen wiederverwendet werden.
Der Mikroplastik-Forscher Christian Laforsch sieht das Plastiktütenverbot an Supermarktkassen vor allem als symbolischen Schritt. »Der Umgang mit Plastiktüten ist symbolisch für unseren unsachgemäßen Umgang mit fossilen Ressourcen«, sagte der Professor für Tierökologie und Sprecher des Sonderforschungsbereichs Mikroplastik an der Universität Bayreuth. Wichtig sei, dass Plastiktüten »nicht durch einmal verwendbare Alternativen ersetzt werden«, bestätigt Laforsch. Auch Umweltverbände begrüßten das Verbot als wichtigen Schritt. Es sei aber »ein fataler Fehler«, so die Deutsche Umwelthilfe, dünne Einweg-Plastiktüten für Obst und Gemüse vom Verbot auszunehmen. Gerade deren Nutzung hat laut Statistischem Bundesamt in den vergangenen Jahren hierzulande deutlich zugenommen: Zwischen 2018 und 2019 deutlich von 688 Millionen auf 3,65 Milliarden Stück.
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.