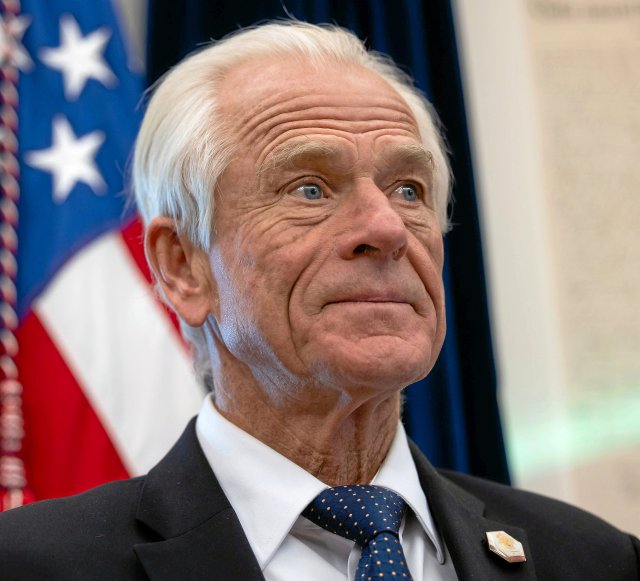- Politik
- Energiepreiskrise
Nur noch kalte Küche
Steigende Preise sürzen Millionen von Briten in eine tiefe Krise. Ein Besuch in einem Donation Hub im Londoner Stadtteil Lewisham

Etwa 40 Leute stehen Schlange hinter einem Absperrgitter, das den Eingangsbereich eines ehemaligen Bürogebäudes umgibt. Die Menge ist ein Querschnitt durch die bunte Gesellschaft des Quartiers: Nebst urigen Londoner Akzenten hört man jamaikanisch gefärbtes Englisch, Arabisch, Somali und Spanisch. Es sind Familien mit Kindern hier, ältere Leute am Stock oder im Rollstuhl, Teenager*innen in Trainingshosen. Sie alle sind zum Lewisham Donation Hub gekommen, am südlichen Ende der geschäftigen Hauptstraße des Stadtteils im Südosten Londons, weil es ihnen an allen Ecken und Enden an Geld fehlt – Geld für den Strom, fürs Essen, für Windeln oder Abwaschmittel.
Es sind beunruhigende Superlative, die den gegenwärtigen Zustand der britischen Wirtschaft beschreiben. Die Inflation liegt bei neun Prozent, das ist der höchste Stand seit vier Jahrzehnten. Der Lebensstandard wird im laufenden Jahr laut Prognosen um über zwei Prozent fallen – so schnell wie noch nie, seit man vor 70 Jahren mit entsprechenden Erhebungen begann. Die Kosten von Strom und Gas sind Anfang April schlagartig um über 50 Prozent gestiegen, im Oktober werden sie noch einmal um mehr als 800 Pfund pro Jahr heraufgesetzt, auf dann durchschnittlich 2800 Pfund (etwa 3280 Euro) – auch das ein Rekord. Die Sozialleistungen hingegen werden in diesem Jahr inflationsbereinigt um fünf Prozent fallen.
Die Konsequenzen sind dramatisch: Das National Institute of Economic and Social Research (NIESR), eine unabhängige Wirtschaftsforschungseinrichtung, schätzt, dass bald zusätzlich mehr als 250 000 Haushalte im ganzen Land in die extreme Armut abstürzen werden. Eine neue Erhebung zeigt, dass bereits jetzt zwei Millionen Erwachsene regelmäßig einen ganzen Tag lang nichts essen, weil sie es sich nicht leisten können.
Pamela Alvarado steht in einer schattigen Ecke neben dem Lewisham Donation Hub und wartet auf ihre Fahrräder. Vor einem halben Jahr kam die 26-Jährige mit ihrer Verlobten und ihrer siebenjährigen Tochter aus El Salvador nach Großbritannien. Die Familie musste vor sexueller Gewalt fliehen, jetzt durchläuft sie das komplexe und perfide britische Asylverfahren – und muss mit 105 Pfund in der Woche über die Runden kommen. Das war schon vorher kaum zu schaffen – jetzt, wo die Preise überall steigen, ist es eine Unmöglichkeit. Alvarados Familie wohnt außerhalb von Stevenage, eine Zugstunde von London entfernt. Jedes Mal, wenn sie ins Zentrum zum Einkaufen wollen, müssen sie fünf Pfund pro Kopf für die Busfahrt hinblättern. Darum haben sie heute den Weg nach London auf sich genommen: Im Donation Hub in Lewisham hat man ihnen drei Fahrräder versprochen – eine einfache Möglichkeit, auf lange Sicht Geld zu sparen.
Drinnen im Gebäude geht es hektisch, aber überaus geordnet zu. Rund 25 freiwillige Mitarbeiter*innen in orangefabrigen Warnwesten wuseln durch die Gänge, nehmen hier ein paar Pakete Fleisch aus dem Tiefkühler, dort ein Kinderspielzeug aus dem Gestell oder zeigen den Hilfsbedürftigen, in welcher Ecke die Pullover liegen. »Seit drei bis vier Monaten haben wir hier so viel Betrieb«, sagt Laurence Smith, der den Donation Hub vor zwei Jahren aufgebaut hat. Überraschend entspannt führt der 37-jährige Chef durch die Räume, bekleidet mit einem bunten Hawaiihemd. »An einem Tag wie diesem kommen rund 220 Leute im Hub vorbei. Wenn wir die Angehörigen hinzuzählen, unterstützen wir täglich etwa 500 Anwohner.«
Der Donation Hub bietet mittlerweile einen Rundumservice. Ein Student wird mit einem Laptop versorgt, eine ältere Frau hat gerade einen Kühlschrank bekommen, den man ihr ins Haus liefern wird. Alles wird gespendet, teilweise von Stiftungen, das meiste jedoch von Einzelpersonen. Und an freiwilligen Mitarbeiter*innen gibt es keinen Mangel: Smith kann auf eine Liste von 250 Leuten zurückgreifen, die sich engagieren wollen. Das ist die andere Seite der Krise: Die Hilfsbereitschaft der Menschen ist enorm.
Aber die Notlagen verschärfen sich ständig. In den vergangenen Wochen hat Smith gemerkt, dass er mehr Produkte braucht, die keinen Strom benötigen – eben händigt er einer Familie einen batteriebetriebenen Mixer aus. »Die Energie kostet so viel, dass sie es sich nicht leisten können«, erläutert der Zentrumsleiter. »Andere Leute sagen von vorneherein: ›Gib mir kein Essen, das ich aufwärmen muss, das Gas ist zu teuer.‹« Auch überlegt er sich, mehr Bücher zu organisieren: »Der Fernseher braucht Strom, Bücher zu lesen ist billiger. Wir sehen hier solch unglaubliche Armut.«
Natürlich hadern viele Länder mit hoher Inflation und teurem Strom. Es ist ein globales Phänomen, mitverursacht durch den Ukraine-Krieg und die Tatsache, dass nach dem Abflauen der Covid-Pandemie überall die Nachfrage nach Energie gestiegen ist. Aber mehrere Faktoren sorgen dafür, dass die Folgen in Großbritannien so dramatisch sind.
Das privatisierte Energiesystem zum Beispiel: Der maximale Preis, den Versorger ihren Kunden für Strom und Gas verrechnen dürfen, wird halbjährlich von der Regulierungsbehörde Ofgem festgelegt. Die jüngste Heraufsetzung dieses Preisdeckels war also eine politische Entscheidung. Die Behörde hätte den geringeren Preis auch beibehalten können – ähnlich wie in Frankreich, wo die Regierung den Preisanstieg in diesem Jahr auf vier Prozent begrenzt hat. Doch hierzulande würde das manchen kleineren Energieanbietern Probleme bereiten, viele würden eingehen und müssten verstaatlicht werden. Nur die großen Betriebe würden einfach weniger Profite schreiben – und die sind derzeit richtig dick: Der Konzern British Gas beispielsweise hat seinen Gewinn schon 2021 verdoppelt.
Dazu kommt, dass der allgemeine Preisanstieg eine Gesellschaft trifft, die nach Jahren des Sozialabbaus bereits auf dem Zahnfleisch geht. Lohnstopps im öffentlichen Sektor, die Beschneidung der Sozialleistungen, eine drastische Sparkur für den Gesundheitsdienst und die Kommunen: Die Politik des vergangenen Jahrzehnts hat an der Existenzgrundlage von Millionen Brit*innen gesägt. Die ärmsten Haushalte haben seit den frühen 2000er Jahren überhaupt keine Erhöhung ihrer Reallöhne erlebt, schreibt der Ökonom Torsten Bell von der Denkfabrik Resolution Foundation. Diese Leute spüren es bereits, wenn der wöchentliche Einkauf ein paar Pfund mehr kostet – ganz zu schweigen von einer monatlichen Stromrechnung, die plötzlich um 50 Prozent höher ist.
Im Lewisham Donation Hub berichtet Laurence Smith von etlichen Leuten, die zum ersten Mal in ihrem Leben überhaupt Hilfe beanspruchen – sie schämen sich richtig, hier aufzutauchen. »Das sind oft Leute, die sich als Teil der Mittelklasse sehen, und jetzt stehen sie auf einmal vor riesigen finanziellen Problemen.« Ende Mai warnte die Chefin des Royal College of Nursing, des Berufsverbands der Pfleger*innen, dass ihre Mitglieder in einer »kritischen Situation« seien: »Wir haben Pfleger, die ihre Miete nicht zahlen können, und andere, die regelmäßig in Suppenküchen essen.« Unterdessen hat auch die Londoner Feuerwehr eine Warnung ausgegeben: Man solle bitte nicht im Wohnzimmer Holzfeuer anzünden, um sich warm zu halten – ein Mann hatte bei einem solchen Versuch sein Haus abgebrannt. Sozialinitiativen haben in den vergangenen Monaten allein in London mindestens 100 solcher Fälle gezählt.
Und was macht die Regierung? Sie besteht seit einem halben Jahr immer wieder darauf, dass sie recht wenig tun könne. Eine andere Reaktion: Der konservative Abgeordnete Lee Anderson meinte kürzlich im Unterhaus, Lebensmitteltafeln wie jene in Lewisham seien »unnötig« – das Problem mit der Armut sei, dass die Leute nicht kochen könnten und auch nicht mit Geld umzugehen wüssten. Premierminister Boris Johnson wiederum sagte, dass Arbeit der beste Weg aus der Armut sei. Diese Platitüde ist in Großbritannien besonders fehl am Platz, denn in der Mehrheit der armen Haushalte arbeitet mindestens eine Person.
Auch Johnsons Finanzminister gab sich lange Zeit hilflos. »Die kommenden Monate werden hart«, sagte Rishi Sunak, der es zusammen mit seiner Frau auf ein Vermögen von 730 Millionen Pfund bringt. »Es gibt keine Maßnahme, die wir als Regierung treffen können, kein Gesetz, mit dem wir die globalen Kräfte über Nacht zum Verschwinden bringen.«
Da Ökonom*innen, Oppositionsparteien und Sozialkampagnen immer nachdrücklicher Sofortmaßnahmen fordern, kam Sunak jetzt offensichtlich zu dem Schluss, dass er doch nicht so machtlos ist. Der Schatzkanzler kündigte ein Hilfspaket im Umfang von 15 Milliarden Pfund an, das vor allem ärmeren Haushalten zugutekommt: Sozialhilfeempfänger*innen beispielsweise werden mit einer Einmalzahlung von 650 Pfund unterstützt. Um dies zu finanzieren, hat die Regierung eine Extrasteuer für Energiekonzerne erhoben, die fünf Milliarden Pfund einbringen soll – eine Idee, die sich die Konservativen von der Labour-Partei abgeschaut haben. Ökonom*innen begrüßten zwar das Hilfspaket, sagten aber auch, es reiche nicht, um Millionen von Menschen vor den steigenden Energiepreisen zu schützen.
Pamela Alvarado, ihre Verlobte und ihre Tochter haben mittlerweile ihre drei Räder in Empfang genommen und machen sich zur Abreise bereit. Die Zugfahrt war teuer, sie werden also nicht so schnell wieder vorbeikommen können. Aber sie bleiben mit Laurence Smith in Kontakt: »Hier haben wir das Gefühl, dass jemand unsere Probleme ernst nimmt.« Solche Aussagen hört man hier oft – und Smith spürt den Druck: »Wir sind gerademal zwei Jahre alt und arbeiten ausschließlich mit Freiwilligen«, sagt er. »Dennoch lasten die Hoffnungen all dieser Menschen auf unseren Schultern. So sollte unsere Gesellschaft nicht funktionieren.«
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.