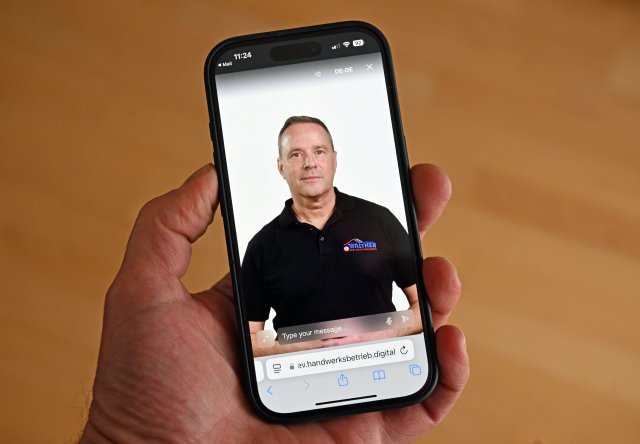- Wirtschaft und Umwelt
- Energiepolitik
Das »schwarze Gold« muss in der Erde bleiben
Der jahrhundertelange Weg vom Kohleaufstieg zum Kohleausstieg in Deutschland
Schon im späten Mittelalter wurde im heutigen Ruhrgebiet Kohle gefördert, etwa für die Nutzung im Schmiedehandwerk. Die ersten Stollenzechen entstanden dort sowie an der Saar im 18. Jahrhundert. Im heutigen Ostdeutschland ging es im Jahrhundert davor los. Die Kohle war eine willkommene Alternative zum knapper werdenden Holz als Brennstoff, sie wurde in Form von Briketts zum Heizen genutzt.
Der eigentliche Boom begann mit der Industrialisierung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts – in der Eisen- und Stahlproduktion, beim Antrieb von Dampfmaschinen und Eisenbahnen sowie in der Farbenproduktion in der Chemieindustrie. Gegen Ende des Jahrhunderts wuchs der Bedarf an Strom, vor allem in der Industrie, aber auch für erste elektrische Straßenbeleuchtungen, später für Privathaushalte. Es entstanden die ersten Elektrizitätswerke in Berlin, im Ruhrgebiet, im Rheinland und in der Lausitz.
Anfang des 20. Jahrhunderts errichtete man große Braunkohle-Tagebaue. Allein in der Lausitz wurden dafür seit 1920 rund 90 Dörfer abgerissen. Im Steinkohle-Bergbau gab es zur Hochzeit um 1960 rund 150 Zechen. Damals arbeiteten im Ruhrgebiet rund 600 000 Bergleute.
Historisch entwickelten sich fünf große Kohlegebiete, Reviere genannt. Im Ruhrgebiet und an der Saar wurde Steinkohle untertage gefördert, am Niederrhein, nahe Leipzig und in der Lausitz Braunkohle im Tagebau. Steinkohle wird inzwischen nicht mehr abgebaut. Ihre über Jahrzehnte durch milliardenschwere Subventionen geförderte Gewinnung lohnte sich gegenüber billiger Importkohle nicht mehr. Im Jahr 2007 beschloss die rot-grüne Bundesregierung, die Subventionen auslaufen zu lassen. Die letzte Zeche, Prosper-Haniel in Bottrop, machte 2018 dicht. Die Tagebaue für die billigere, aber besonders CO2-trächtige Braunkohle wurden weiter betrieben.
Bereits 1990, kurz nach der Wende, war hingegen klar: Ein kompletter Kohleausstieg ist notwendig, um die Klimaschutzerfordernisse zu erfüllen. Die erste Enquete-Kommission des Bundestages empfahl damals eine deutliche Verringerung der Kohleverstromung bereits bis 2005, umgesetzt wurde das nicht. Unter der rot-grünen Bundesregierung und den nachfolgenden Merkel-Regierungen wurden sogar neue Kohlekraftwerke gebaut. Das letzte davon, Datteln 4, ging im Ruhrgebiet noch 2020 ans Netz.
Erst ein Vierteljahrhundert nach dem Klimaaufschlag von 1990 kam der Ausstieg auf die politische Agenda. Vorher hatte eine vereinte Lobby aus Stromkonzernen und Gewerkschaften, Union, FDP und großen Teilen der SPD verhindert, dass Kohlekraftwerke in nennenswertem Maße vom Netz gingen. 2016 handelte die Bundesregierung dann mit den Konzernen eine Teil-Stilllegung von einigen besonders klimaschädlichen Kohleblöcken für die Jahre 2016 bis 2019 aus. Sie wurden in eine »Sicherheitsbereitschaft« überführt, um sie bei Bedarf wieder hochfahren zu können, was nie geschah – die vereinbarte Entschädigung von satten 1,6 Milliarden Euro für den »Phantomstrom« müssen die Stromkunden über die Netzentgelte aufbringen.
Der Druck, den Ausstieg zu beschleunigen, war nach der Verabschiedung des Pariser Weltklimavertrags Ende 2015 stark gewachsen. Der Merkel-Groko dämmerte 2018: Ein echter Ausstiegsplan muss her. Die Aufgabe, diesen zu entwickeln, delegierte sie jedoch an ein zivilgesellschaftliches Gremium. Die »Kohle-Kommission« legte 2019 ihre Blaupause für einen Kohleausstieg bis spätestens 2038 vor. Selbst Umweltschützer*innen, die 2030 angepeilt hatten, sprachen von einem »Wendepunkt für die energiepolitischen Fragen in Deutschland«.
Die Ausstiegsblaupause wurde von der Merkel-Regierung mit Abstrichen beschlossen, wobei vor allem die Braunkohleländer im Osten mehr herausholten. Über 20 Jahre sollen danach rund 40 Milliarden Euro an Strukturhilfen fließen, zudem wird die Ost-Braunkohle bis weit in die 2020er Jahre von Abschaltungen verschont. Damit schien der Konflikt vorerst beruhigt, freilich um den Preis, dass die Paris-Vorgaben und auch die Beschlüsse der Bundesregierung zur Klimaneutralität nicht einzuhalten wären. Die neue Ampel-Regierung formulierte das Ziel, den Ausstieg »idealerweise« auf 2030 vorzuziehen. Das umzusetzen, entpuppte sich alles andere als einfach. Denn wegen Putins Ukraine-Krieg wich die Ampel sogar vom bisherigen Ausstiegspfad ab und ließ eigentlich schon stillgelegte Kraftwerke wieder ans Netz nehmen. Folge: Der CO2-Ausstoß im Energiesektor nahm zu.
Um trotzdem 2030 als Enddatum für die Kohle halten zu können, präsentierte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck mit seiner NRW-Kollegin Mona Neubaur (beide Grüne) im Sommer einen Deal mit dem Energiekonzern RWE, im Niederrhein-Revier zunächst mehr Kohle abzubauen, um die reaktivierten Meiler betreiben zu können, die Braunkohle-Nutzung dort aber bereits 2030 zu beenden. An dem Kompromiss entzündeten sich heftige Auseinandersetzungen – weil das umkämpfte Dorf Lützerath damit zum Abriss freigegeben wurde und weil Studien renommierter Institute ergaben, dass die dortige Kohle zur Sicherung der Energieversorgung bis 2030 nicht mehr benötigt wird.
Der Konflikt in NRW gibt einen Vorgeschmack darauf, wie kompliziert die Verhandlungen über ein Vorziehen des Ausstiegs auf 2030 auch in Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt sein werden. Die an Rhein und Ruhr regierende Koalition von CDU und Grünen hatte das frühere Daum im Koalitionsvertrag verankert. Die Ost-Ministerpräsidenten wollen sich dem Thema überhaupt nur nähern, wenn der Ausstieg ausreichend »abgefedert« wird. Soll heißen: wenn der Bund weitere Milliarden dafür auf den Tisch legt.
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.