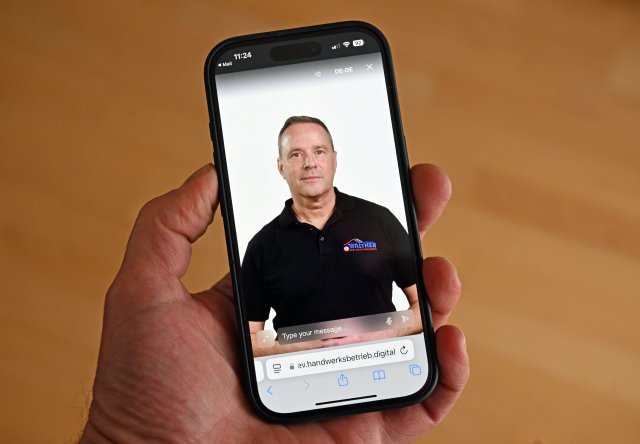- Wirtschaft und Umwelt
- Finanzmärkte
Lehren aus dem Doppelbeben der Banken
Selbst Staatsanleihen sind riskant, wenn Geldhäuser ihr Geschäft nicht beherrschen
Bei vielen wecken stürzende Banken Schadenfreude. Dafür gibt es gute Gründe. Doch jede Bankenkrise kann für eine Volkswirtschaft zu einer höchst bedrohlichen Angelegenheit werden: Kleinen und großen Unternehmen wird der Geldhahn zugedreht, die Industrie streicht Arbeitsplätze, und Menschen in Not kommen nicht mehr an ihr sauer Erspartes. So löste die große Finanzkrise 2008 eine Weltwirtschaftskrise aus. Stürzende Banken gefährden vor allem die Realwirtschaft.
Die jetzt untergegangene Silicon Valley Bank (SVB) ist Teil dieses »systemischen Risikos« für die Wirtschaft. Sie gilt als Hausbank vieler Technologiefirmen und Start-ups im Silicon Valley, der Heimat von Plattform-Riesen wie Google oder Meta (Facebook). Das Geschäft der SVB dürfte an sich im Lot gewesen sein. Aber ihr Chef Greg Becker und seine Vorstandskollegen haben sich mit Investitionen in Anleihen verkalkuliert, die als sichere Geldanlage angesehen werden. Becker beherrschte jedoch nicht das Kerngeschäft jeder Bank: die Fristentransformation. Die Laufzeiten der Spareinlagen der Kunden müssen den Laufzeiten entsprechen, die für Kredite und andere Anlageformen gelten.
Die SVB hatte – wie andere US-Banken – viel Geld in langlaufende Staatsanleihen und andere solide Wertpapiere gesteckt, als die Zinsen dafür niedrig waren und der Kurs dementsprechend hoch war. Mit der geldpolitischen Wende und den stark steigenden Zinsen sank der Marktwert dieser Anleihen rapide, teils auf 70 Prozent des Ausgabepreises. Das macht keine Probleme, solange die Papiere bis zum Ende ihrer Laufzeit gehalten werden, denn dann kriegt die Bank von ihren Schuldnern 100 Prozent zurückgezahlt (plus Zinsen). Verkauft die Bank die Wertpapiere allerdings vor ihrer Endfälligkeit, werden Kursverluste »realisiert«. Genau das tat die SVB: Am 8. März gab sie bekannt, dass sie Wertpapiere mit Verlust verkauft habe, um flüssig zu sein. Daraufhin setzte ein Sturm der Bankkunden ein, die um ihre Guthaben fürchteten. Beckers Bank war pleite.
Ähnlich könnte es noch anderen mittelgroßen US-Banken ergehen. Nach Angaben der staatlichen Einlagensicherungsbehörde FDIC betragen die unrealisierten Verluste im heimischen Bankensystem stattliche 620 Milliarden Dollar. Um einen landesweiten »Bank-Run« zu verhindern, schnürten FDIC, Zentralbank Fed und die Regierung von Präsident Joe Biden ein Rettungspaket, das selbst hohe Einlagen absichert.
Auch das Beben in der Schweiz lösten Vorstände aus, die ihr Geschäft nicht beherrschten. So bildete die Führung der Credit Suisse (CS) nicht ausreichend Reserven, um für schlechte Zeiten gerüstet zu sein. Und sie setzte massiv auf das riskante und schwankungsanfällige Investmentbanking auf eigene Rechnung. Ein üppiges Bonussystem lud zudem die Banker ein, übergroße Risiken einzugehen, ohne sich um mögliche spätere Verluste zu scheren. Das führte zu Engagements in dubiosen Schattenbanken wie Greensill und Archegos, deren Bankrott CS viele Milliarden Franken kostete.
Die Credit Suisse, die nun von der größeren UBS übernommen wird, »hatte eine Führungscrew mit sehr wenig Bankerfahrung, die die Risiken nicht im Griff hatte«, analysiert der Schweizerische Gewerkschaftsbund. Ein Verantwortlicher sei aus der Versicherungsbrache gekommen, ein anderer von einem TV-Sender und ein dritter aus der Pharmaindustrie.
Der Fall der Schweizer Großbank unterscheidet sich in vielen Punkten von dem Fall der US-Banken. Doch neben Vorständen, die ihr Handwerk nicht verstehen, gibt es eine weitere wesentliche Gemeinsamkeit: die Fehler der Politik in der Regulierung. Aus dem Grundübel der Finanzkrise wurde offenbar zu wenig gelernt. Mit »Basel III« war seinerzeit ein neues Regelwerk vorgelegt worden, das weltweit implementiert werden sollte. Das ist bis heute nicht geschehen. Internationale Interessengegensätze, Lobbyarbeit und überforderte Politiker bremsen »Basel III« aus. US-Präsident Donald Trump lockerte sogar die Regeln für mittelgroße Banken wieder, die jetzt kriseln.
So gingen im Laufe der Jahre in der Krise populäre, eher linke Forderungen nach Kapitalkontrollen oder einem Trennbanksystem ganz unter. Und zugleich eine grundlegende Erkenntnis, die viele unabhängige Experten aus allen wissenschaftlichen Lagern teilen: Es gibt keine risikolosen Bankgeschäfte. Selbst der Kauf von Staatsanleihen mit dem höchsten Rating, die quasi als ganz sicher gelten, beinhaltet ein Restrisiko. Zwar kein Ausfallsrisiko (der Staat wird wohl seine Schulden tilgen), aber ein Zinsrisiko.
Abhilfe, um Banken krisenfester zu machen, könnte nur die staatliche Vorgabe bringen, deutlich mehr Eigenkapital schaffen zu müssen. Doch auch nach der Finanzkrise wurde am Konzept des »risikogewichteten« Kapitals festgehalten. Für Staatsanleihen und ähnlich sichere Anlagen müssen Banken daher kein oder wenig Eigenkapital auf die Habenseite legen. Eine Reform böte zugleich die Chance, das komplizierte Regelwerk zu vereinfachen. Die entscheidende Sicherheitsnorm wäre dann das Verhältnis von Eigenkapital zur Bilanzsumme. Flankiert werden müsste dies mit rigiden Beschränkungen für riskante Geldanlagen wie Aktien – dies gibt es für die Versicherungswirtschaft.
Da die Finanzmärkte global vernetzt sind, müssten solche Regeln ebenfalls global gelten. Dies dürfte aber keine realistische Option sein. Wenn schon aus dem Grundübel der Finanzkrise zu wenig gelernt wurde, dürfte das aktuelle Doppelbeben, so es denn dabei bleibt, erst recht nicht dazu beitragen, die Banken und Schattenbanken zur Lösung des Problems zu verpflichten.
Der deutsche Ökonom Rudolf Hickel vergleicht die Finanzmärkte mit einem Vulkan, dessen »andauernd brodelndes Magma sich kaum vorhersehbar in Eruptionen entlädt«. Daran würde auch eine stabilitätsorientierte Regulierung nichts Grundlegendes ändern. Genau hier schlummert die dritte Lehre aus dem Doppelbeben: Irgendwelche Banker finden immer einen Dreh, um überdurchschnittlich profitable und entsprechend risikoreiche Geschäfte zu machen. Es gibt damit auch keine Sicherheit für die Realwirtschaft.
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.