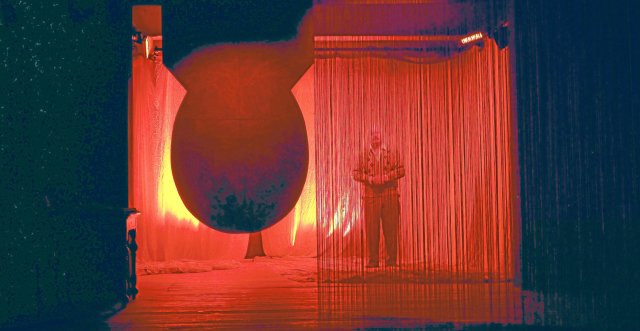- Berlin
- Geflüchtete
Geflüchtetenhilfe in Berlin: Selbstverwaltet gegen Grenzen
Seit 40 Jahren setzt sich die Kontakt- und Beratungsstelle in Kreuzberg für die Rechte Geflüchteter ein

Zwei Stockwerke, 30 bezahlte Stellen, knapp 200 Ehrenamtliche und morgens von Montag bis Freitag eine Menschenschlange auf dem Gehsteig vor der Oranienstraße 159 in Kreuzberg: Die Kontakt- und Beratungsstelle für Flüchtlinge und Migrant*innen, kurz Kub, ist in den vergangenen Jahrzehnten zu einer festen Institution der Berliner Geflüchtetenhilfe geworden.
Menschen, die sich auf ihre Asylanhörung vorbereiten wollen oder gegen eine Ablehnung klagen. Menschen, die wegen Gewalt oder Traumata dringend ihre Unterbringung verlassen müssen, die nach psychologischer Beratung ohne Krankenversicherung und ohne rassistische Therapeut*innen suchen. Menschen, die kostenlos Deutsch lernen wollen, die für eine Arbeitserlaubnis kämpfen oder die wegen drohender Abschiebung dringend juristische Unterstützung brauchen. Sie alle kommen zur Kub. Und das seit 40 Jahren.
»Über die ersten 20 Jahre wissen wir nicht so viel«, sagt Stephen Sulimma. Der Sozialarbeiter kam 2001 als Praktikant zur kub – und ist geblieben. Als er anfing, waren kaum noch Gründer*innen von 1983 dabei. Was er weiß: Den Grundstein legte eine Gruppe von Migrant*innen aus Zentralasien, die sich zur Selbsthilfe zusammenschlossen. Sie teilten ihr Wissen zu Aufenthalts- und sozialrechtlichen Fragen mit neuen Ratsuchenden, wurden größer und professionalisierten sich. »Dann ist es Ende der 90er Jahre intern implodiert.« Auf seiner ersten Mitarbeiterversammlung sollte Sulimma als Praktikant die Vereinsauflösung protokollieren. »Das Team hat sich dann doch dagegen entschieden. Aber man kann von einer Art Neuanfang sprechen.«
22 Jahre später sitzt Sulimma mit drei Kolleginnen im vierten Geschoss des Kreuzberger Altbaus in dem Zimmer, wo normalerweise die Deutschkurse stattfinden. Selbstgemalte Plakate mit den Farbworten und den Wochentagen hängen an der Tür. Auf einem Papier stehen Regeln zum »miteinander Reden«: »Ich lasse andere ausreden«, »Ich respektiere andere Perspektiven«. Die Umgangsformen gelten nicht nur für die Sprachkurse. Seit der Neuaufstellung Anfang der 2000er legt der Verein Wert auf flache Hierarchien. In wöchentlichen Teamsitzungen treffen angestellte und ehrenamtliche Mitarbeiter*innen Konsensentscheidungen und verwalten sich selbst.
Arbeiten ohne Chefs – in den Augen von Ekaterina Raykova funktioniert das sehr gut. Raykova arbeitet in der Sprachmittlung und im Erstkontakt, hat also mit den Menschen zu tun, die zum ersten Mal zur Kub kommen. Sie schätzt die Diskussionen, die einer Team-Entscheidung vorausgehen. Wie etwa im Fall einer Büro-Maus. »In der Anwesenheit dieser Maus konnte eine Kollegin nicht arbeiten.« Eine Lösung musste her. »Wir haben alle unsere Positionen zu der Maus geteilt, und am Ende wurde das Tier gerettet und aus dem Haus geschafft.«
»Aber wir arbeiten trotzdem ziemlich effizient«, betont Julia Scheurer. Die Psychologin ist seit sieben Jahren in der psychosozialen Beratung tätig, seit fünf Jahren hat sie eine feste Stelle. In anderen Bereichen könnte sie mehr Geld verdienen. »Aber hier wird sehr auf das Wohl der Mitarbeitenden geachtet, man wird nicht verheizt«, sagt sie.
»Aber man muss trotzdem aufpassen, dass man sich nicht selbst verheizt«, entgegnet Sarah Neumann. Sie ist seit zwei Jahren in der Rechtsberatung tätig, fing so wie viele als Ehrenamtliche an und ist seit kurzer Zeit angestellt. Es gibt zwar keine Leitung, die auf Produktivität pocht. Dafür müssen die Mitarbeiter*innen der Kub selbst darauf achten, nicht in Arbeit unterzugehen.
Zur Rechtsberatung kommen etwa illegalisierte Menschen, die sonst keine andere Anlaufstelle haben, oder schwangere Frauen ohne Aufenthaltstitel, die in Berlin drei Monate vor und nach der Geburt eine sogenannte Schwangerschaftsduldung beantragen können. »Wir haben viele Menschen, die marginalisiert sind, queere Personen, gewaltbetroffene Frauen, Menschen mit schweren Krankheiten, Personen aus besonders diskriminierten Gruppen wie Rom*nja«, erzählt Neumann. »Es ist ein unfassbarer Bedarf da, wir schicken jeden Tag Leute weg.« Dann nicht doch noch nach Dienstende die letzte wartende Person zu beraten, sei keine einfache Entscheidung. Vor allem, wenn es um existenzielle Fragen geht.
Work-Life-Balance, die Trennung von Beruflichem und Privaten – wenn die Arbeit Teil eines politischen Kampfes ist, vermischt sich »Work« und »Life« automatisch. Die Kub versteht sich nicht als Wohlfahrtseinrichtung, sondern positioniert sich gegen Rassismus, Grenzgewalt, Abschiebungen und die Aushöhlung des Asylrechts. Das lässt sich schon in den Räumlichkeiten erkennen. Ein Sticker vom »Deportation Alarm«, eines Informationskanals, der vor Abschiebungen warnt, klebt an der Tür, im Erdgeschoss fordert ein Plakat gleiche Rechte für »mujeres sin papeles«, also Frauen ohne Papiere.
Das Selbstverständnis schlägt sich in der Arbeit nieder. Die Rechtsberatung will so viel wie möglich für die Ratsuchenden herausholen. »Wir stellen nicht die Geschichte der Leute in Frage oder bewerten, wer welches Recht verdient hat«, sagt Neumann. »Wir sind ganz klar parteiisch.« Die psychosoziale Beratung lässt nicht die strukturellen Probleme wie Rassismus, Grenzgewalt und Armut außen vor, wenn es um individuelle psychische Belastungen geht. Gerade wenn Menschen für längere Zeit in unsicheren Aufenthaltssituationen steckten, wirke sich das krass auf ihre Psyche aus, erzählt die Psychologin Scheurer. »Die Erkenntnis: Ich komme nicht so schnell weiter, wie ich mir das vorgestellt habe, ich stecke fest – das ist eine zermürbende Wartesituation.«
Die Situation Geflüchteter und Migrant*innen in Berlin ist über die Jahre nicht einfacher geworden. So erzählen Ratsuchende regelmäßig von katastrophalen Zuständen in den Asylunterkünften. »Vor allem über Tegel hören wir furchtbare Berichte von Übergriffen durch die Security-Mitarbeiter«, so Neumann. Ein Berlin-spezifisches Problem, mit dem die Menschen regelmäßig zur Kub kommen, liegt außerdem in der Verwaltung: Das Landesamt für Einwanderung vergibt viel zu wenige Termine. »So viele Leute kommen, weil sie ihren Titel nicht rechtzeitig verlängert kriegen«, sagt Neumann. Das könnte im schlimmsten Fall zur Obdachlosigkeit führen, wenn ohne gültige Papiere die Leistungen gekürzt würden.
Mittlerweile macht sich in der Kub die schwarz-rote Politik bemerkbar. Lange galt die Abschiebepraxis in Berlin als humaner als die anderer Bundesländer. »Wir beobachten, dass sich das verändert. Es werden jetzt zum Beispiel auch Familien mit minderjährigen Kindern getrennt.« Das kann Raykova aus ihren Erstgesprächen bestätigen. Und: »Wir hören immer mehr Berichte, wo Menschen vor einer Abschiebung inhaftiert werden.«
Es wird wohl nicht besser. Mit Blick auf die bundespolitischen Debatten zu »vereinfachten Rückführungen« und den Plänen der EU, mit dem Gemeinsamen Europäischen Asylsystem das Asylrecht für einen Großteil der Ankommenden auszuhebeln, muss die Kub mit immer weiter wachsendem Bedarf rechnen – und mit politischem Gegenwind. Der Verein musste bereits finanzielle Engpässe überstehen. Der Umfang der Förderung durch den Senat, der eine Frauenfachstelle finanziert, ist ungewiss, auch die Mittel, die vom Innenministerium kommen, stehen auf der Kippe.
Obwohl der Verein diese Förderungen gut gebrauchen kann, macht er sich nicht mit dem System gemein, wie Sulliman betont. »Wir sagen immer, dass wir selbstverständlich auch prekarisierte Menschen beraten und gegen Abschiebungen sind.« Wenn die Gelder wegfielen, würde die Kub andere Lösungen finden. »Wir sind pfiffig.«

nd.Muckefuck ist unser Newsletter für Berlin am Morgen. Wir gehen wach durch die Stadt, sind vor Ort bei Entscheidungen zu Stadtpolitik - aber immer auch bei den Menschen, die diese betreffen. Muckefuck ist eine Kaffeelänge Berlin - ungefiltert und links. Jetzt anmelden und immer wissen, worum gestritten werden muss.
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.