- Kultur
- Rambazamba-Theater
Aeoricircus: »Das Orakel kann mich mal!«
Ein Zirkusabend mit zu viel Zeigefingerkritik im Haus der Berliner Festspiele

Das Publikum steht im Dunkeln. Nur ein Scheinwerfer erzeugt ein weißes Loch Licht auf einer Wand. Dann erklingt über unseren Köpfen eine Stimme (von Angela Winkler): Die Erde sei hin, man könne nicht mehr sagen, ob die Geräusche dieser Welt von Naturphänomenen oder Schlachten kommen. »Staub drauf« statt Schwamm drüber.
Plötzlich mischt sich eine Pantomimin zwischen uns Gäste, wird von einer ruckeligen Kamera begleitet, öffnet den sie beobachtenden Pulk, spielt, das behauptet zumindest die Stimme, mit Heuschrecken, lässt Vögel los: eine Vorbotin des Zirkus, des »Aeoricircus«. Viele der Schauspieler und Musiker sind vom Berliner Rambazamba-Theater, das sich seit 1992 um inklusives Theater verdient macht. Die Ensemble-Mitglieder mit sogenannter geistiger Behinderung sind auf verschiedenen Bühnen und im Film aktiv. An diesem Abend (Regie: Jacob Höhne) sollen sie das Haus der Berliner Festspiele in einen kapitalismuskritischen Karneval verwandeln mittels eines Textes des Dramatikers Thomas Köck. Die Darsteller, die »anders« sind, besitzen laut Text Superkräfte, was ihnen ermöglichte, das Ende der Welt zu überleben.
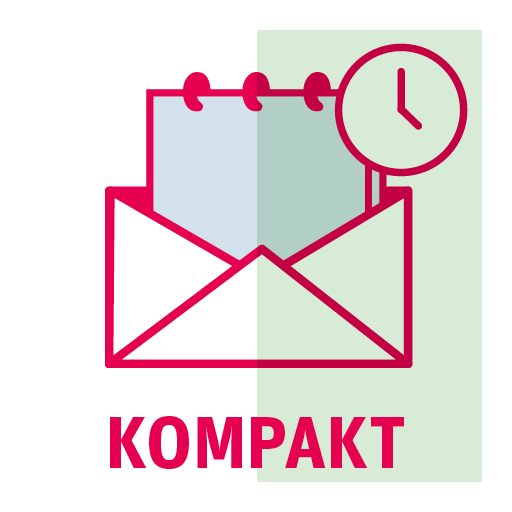
Unser täglicher Newsletter nd.Kompakt bringt Ordnung in den Nachrichtenwahnsinn. Sie erhalten jeden Tag einen Überblick zu den spannendsten Geschichten aus der Redaktion. Hier das kostenlose Abo holen.
Ob diese Wertung von Anderssein nötig ist, lässt sich diskutieren. Aber Überleben jedenfalls schützt nicht vor internen Querelen und Sinnsuche. Denn plötzlich schreit eine zweite Stimme weit oben über uns: Sie hat keinen Bock mehr auf den Zirkus. Eine ominöse Autorität, ein Orakel wird beklagt: »Das Orakel kann mich mal.«
Am Anfang die expressive Arbeitsverweigerung. Nach diesem Präludium auf der Hinterbühne fährt ein Metalltor nach oben und das Publikum muss Platz nehmen. Für die Raumgestaltung wurde der Künstler Tomás Saraceno engagiert. Vier große transparente Kugeln hängen von der Decke. Für solche Installationen ist er bekannt. Nun ja. Wir erfahren: Wir im Publikum beziehungsweise die Menschen der Erde allgemein sind tot. Das Stück spielt in einer Zukunft, in der sich die Menschheit in blinder Profitgeilheit ausgelöscht hat, sich die Luft zum Atmen nahm. Vier Schauspieler erörtern die Apokalypse, machen aus dem defätistischen Satz »This is it« einen repetitiven Zungenbrecher – dann bricht irgendwann der große Zirkus los.
Kostümplastiken afrikanischer Tiere, ein Elefant, ein Zebra, ein Nashorn, bewegen sich über die Bühne. Allerlei Akrobatik wird geboten. Ein fröhliches Durcheinander. Aber die Artisten unter der Zirkuskuppel sind auch ratlos: Eine Seiltänzerin beklagt die »soziale Schwerkraft«, der sie sich ausgesetzt fühlt. Immer wieder ist von »Wachsen und Verschwinden« die Rede: Ökonomische Expansion eliminiert natürliche Vielfalt. Und das Orakel (gespielt von Ilse Ritter) wiederholt: »Der Zirkus hat keinen Auftrag.«
Klingt da der Wunsch nach autonomer Kunst an? Die Autorität des Orakels wird infrage gestellt von einem unzufriedenen Clown, der den Aufstand proben will. Der Text, das Stück selbst – kompletter Titel: »aerocirucs – eine circensische karnevaleske mit planwagen/entgegen aller linearitäten« – lässt den Wunsch nach Revolte nicht zu. Stattdessen werden Klagen über das böse Tun der CEOs und Managersäcke laut: Allerweltsweisheiten. Man fühlt sich ideologisch abgespeist und will eigentlich nicht, dass zwei Stunden immer wieder Spieler solche Plattitüden unironisch vertreten müssen.
Im Oberrang hinter dem Publikum findet ein Puppentheater statt: Da wird die Vergangenheit der alten Erde garstig kommentiert wie in der Muppet-Show. Eine Band spielt eine Interpretation von »This is the End« – die Premiere war drei Tage vor Jim Morrisons 80. Geburtstag. Das schafft Atmosphäre. Der Boxkampf zwischen zwei Puppen, von denen eine die Wissenschaft und die andere die freie Marktwirtschaft repräsentiert, ist wiederum albern und als Kritik an dem, was in der Gesellschaft falsch läuft, zahnlos. Die unvermittelten sexuellen Ausbrüche zwischen einigen Darstellern und Puppen sind deplatzierte Effekthascherei.
Wenn dem Karnevalsspektakel Raum gegeben wird, entwickelt sich Spielfreude bei manchen Darstellern. Sobald das Bühnengeschehen sich auflöst, kommt zirzenische Freiheit auf. Ein Highlight ist die verstörende Fassung von »Hoch auf dem gelben Wagen«. Eine Messerwerferin und Schwertschluckerin verarscht das Publikum kurz vor Schluss, stellt vielleicht das Geifern nach Transgression irgendwo bloß, bleibt aber Joke.
Köcks Text, der in der Beschreibung dystopischer Welten schöne Stellen hat, dominiert den Abend durch flache, verkürzte Kritik eines Umweltverschmutzungskapitalismus. Dass die große Komödie unterschiedlichster Individuen der universalen Tragödie vorzuziehen ist, wie in einer der letzten Szenen superdiskursiv konstatiert wird, dem kann man zwar zustimmen. Bedauerlich ist nur, dass immer wieder im Publikum an den falschen Stellen gelacht wird, weil einige der Darsteller ins Stocken geraten, weil Inszenierung und Text nicht die Stärken der Rambazamba-Crew herausstellen können. Das hinterlässt den Eindruck, dass über ihre Köpfe hinweg ein Konzept verfolgt wurde, das, wie so oft bei Anthropozän-Kunst, über die Menschen hinwegsieht.
Nächste Vorstellungen: 9. und 10.12.
Wir haben einen Preis. Aber keinen Gewinn.
Die »nd.Genossenschaft« gehört den Menschen, die sie ermöglichen: unseren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die mit ihrem Beitrag linken Journalismus für alle sichern: ohne Gewinnmaximierung, Medienkonzern oder Tech-Milliardär.
Dank Ihrer Unterstützung können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen sichtbar machen, die sonst untergehen
→ Stimmen Gehör verschaffen, die oft überhört werden
→ Desinformation Fakten entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und vertiefen
Jetzt »Freiwillig zahlen« und die Finanzierung unserer solidarischen Zeitung unterstützen. Damit nd.bleibt.







