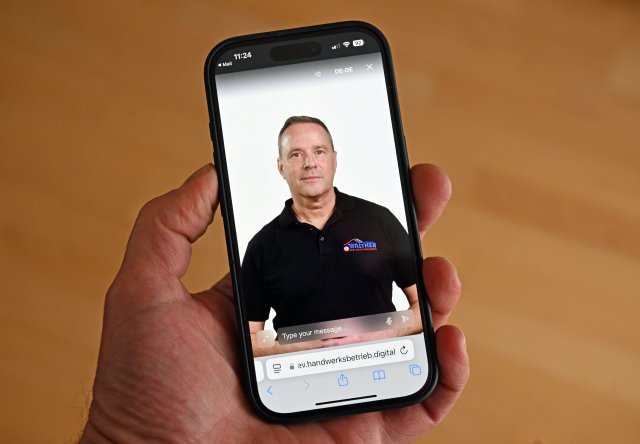- Wirtschaft und Umwelt
- Kritik der Lohnarbeit
Zeitwohlstand statt Arbeitsfetisch
Gegen Erwerbslosigkeit und neoliberale Umstruktierung des Arbeitsmarktes entstand in der Nachwendezeit eine breite Bewegung

Vom Ende der 1990er bis in die Mitte der 2000er Jahre bestand in der Bundesrepublik eine sehr hohe Erwerbslosigkeit. Ich erlebte damals selbst, wie auch verstärkt arbeitskritische Debatten geführt wurden. Diese scheinen heute – in Zeiten des sogenannten Fachkräftemangels – vergessen zu sein, obwohl viele Menschen von ihrer Lohnarbeit erschöpft sind.
Ich habe zwei Leben. Als der Staat begann, Akten über mich als eine für den Produktionsprozess »überflüssige« Person anzulegen, baute ich mir eine Parallelwelt auf. In diesem anderen Leben jenseits der Lohnarbeit versuchte ich, nach meinen Bedürfnissen und Fähigkeiten tätig zu sein und konnte meine Zeit durch meine zumeist ehrenamtlichen Aktivitäten sinnvoll nutzen. Angesichts meiner damaligen Erfahrungen als Erwerbslose war ich umso verwunderter, dass die »Zeit«-Journalistin Anna Mayr als »Arbeitslosenexpertin« gehandelt wurde, als sie im Jahre 2020 das Buch »Die Elenden« veröffentlichte. Darin schreibt Mayr, deren Eltern ihrerseits langzeitarbeitslos waren, ihr werde die Position zugestanden, den Arbeitslosen stellvertretend eine Stimme zu geben.
Von glücklichen Arbeitslosen
Obwohl »Die Elenden« gut geschrieben ist, empfand ich nach der Lektüre ein gewisses Unbehagen, und zwar wegen der den Arbeitslosen zugewiesenen Opferrolle und einiger Leerstellen. Erwerbslose tauchen in dem Buch nicht etwa als Akteur*innen auf, sondern werden zu untätigen Nichtstuer*innen degradiert. Wer nicht arbeite, der sei gewissermaßen ein Nichts, denn ohne einen Beruf sei das Leben sinnlos: »Wenn aber Arbeit dem Leben einen Sinn gibt, dann bedeutet Nicht-Arbeit, dass man gesellschaftlich bereits tot ist«, schreibt Mayr. Und ja, es gibt die Arbeitslosen, die an ihrer Situation leiden – aber es gibt eben auch die, die zwar keiner Lohnarbeit nachgehen, aber anderweitig erfüllenden Tätigkeiten.

Mit unserem wöchentlichen Newsletter nd.DieWoche schauen Sie auf die wichtigsten Themen der Woche und lesen die Highlights unserer Samstagsausgabe bereits am Freitag. Hier das kostenlose Abo holen.
Die Debatte über die Kritik der Lohnarbeit kommt in Anna Mayrs Buch nicht vor. Meine eigene Auseinandersetzung mit dem Thema begann, als ich Mitte der 90er Jahre meine Diplomarbeit über »diskontinuierliche Erwerbsbiografien« im Ost-West-Vergleich schrieb und mich in einem Artikel für die Arbeitslosenzeitung »quer« mit der Arbeitsgesellschaft DDR und der dortigen Kriminalisierung von »arbeitsscheuem Verhalten« (Paragraf 249 StGB der DDR) beschäftigte. Im Jahr 1997 initiierte ich die »Hängematten«, eine heterogene Gruppe von Erwerbslosen aus Ost und West.
Einige von uns ließen sich in ihrer politischen Tätigkeit von der Schrift »Recht auf Faulheit« des französischen Sozialisten Paul Lafargue aus dem Jahr 1880 inspirieren, in der er sich kritisch mit der 1848 aufkommenden Forderung nach einem »Recht auf Arbeit« auseinandersetzte. Die Arbeiterklasse sei von einer rasenden Arbeitssucht beherrscht, heißt es dort. Auch das »Manifest gegen die Arbeit« der Gruppe Krisis, veröffentlicht 1999, war für uns bedeutend. Es beginnt mit den provozierenden Worten: »Ein Leichnam beherrscht die Gesellschaft – der Leichnam der Arbeit.« Im Rahmen einer Veranstaltung der »Hängematten« gründete sich damals die kleine Gruppe »Feierabend«, benannt nach dem gleichnamigen Buch, das im Jahr 1999 von der Gruppe Krisis veröffentlicht wurde. Darin arbeitet der Autor Götz Eisenberg die bürgerliche Herkunft der hohen Wertschätzung der Arbeit heraus. Während die Menschen anfangs noch vor den Verhaltenszumutungen der Lohnarbeit geflohen seien, werde Arbeitslosigkeit in der Folge eines langen »Dressurprozesses« durch die kapitalistischen Verhältnisse schließlich als sozialer Tod erlebt.
Eine weitere Organisierung zum Thema Lohnarbeitskritik waren die »Glücklichen Arbeitslosen« die sich im August 1996 im Berliner Prater gegründet hatten. Unter anderem initiierten sie »Spaziergänge«, verstanden als kollektives Herumstreifen, und veröffentlichten das »Manifest der Glücklichen Arbeitslosen«, was eine gewisse Berühmtheit erlangte. Die Gruppe betrachtete es als ihre »altruistische Pflicht«, die »Mangelware Arbeit« denen zu überlassen, die sie partout wollten, aber selbst darauf zu verzichten. Die Aktivist*innen hatten viel Zeit, brauchten aber auch Geld als Voraussetzung für ein behagliches soziales Leben, wie sie in ihrem 2002 veröffentlichten Buch »Mehr Zuckerbrot, weniger Peitsche« feststellen.
So hielt durch die schreibmächtigen »Glücklichen Arbeitslosen« endlich wieder die Kritik der Arbeit Einzug in linke Debatten. Noch in den 1970er Jahren, so die Autor*innen, hätten die Arbeiter*innen ihre eigene Arbeit und auch die Arbeit an sich infrage stellen können. Nun müssten sie Zufriedenheit heucheln, weil sie nicht arbeitslos sind, während die Arbeitslosen, nur weil sie keine Arbeit haben, Unzufriedenheit vorzutäuschen hätten. Ihr Gegenvorschlag: Die Schaffung eines »artgerechten Biotops für Glückliche Arbeitslose« würde auch die Lage der Arbeiterschaft verbessern, die Angst vor Arbeitslosigkeit würde abnehmen und der Mut, sich zu widersetzen, gestärkt.
Anders arbeiten – oder gar nicht?
Mit der Einführung von Hartz IV 2005 änderte sich die Situation auf dem deutschen Arbeitsmarkt aber noch einmal drastisch. Wer die Chancen hatte und gut genug funktionierte, wechselte in die Lohnarbeit, um der Armut und Drangsalierung zu entkommen – auch unter linken Lohnarbeits-Kritiker*innen. Heute scheinen jene aufmüpfige Haltung von Arbeitslosen und konsequente Lohnarbeitskritik völlig aus der Zeit gefallen.
Ich selbst war ab dem Jahr 2002 in der Initiative »Anders arbeiten oder gar nicht« aktiv, die aus dem gleichnamigen Kongress hervorging. Wir führten eine »Spiegelstrichdebatte«, in der wir kontrovers unsere Forderungen diskutierten. So sprachen wir uns für ein Recht auf Existenz im Sinne einer bedingungslosen Teilhabe am gesellschaftlichen Leben aus: ohne Arbeitszwang, ermöglicht durch ein ausreichend hohes garantiertes Grundeinkommen (Existenzgeld). Ein Vorschlag, nach dem die gestiegene gesellschaftliche und industrielle Produktivität »für eine allgemeine und weit gehende Entlastung von Arbeit und für die Vermehrung von frei verfügbarer Lebenszeit« genutzt werden sollte, wurde in der Debatte als elitär abgelehnt. Denn viele Menschen, so das Gegenargument, seien ja schon von der Lohnarbeit entlastet, obwohl sie eigentlich arbeiten wollen.
Ein anderer Kritikpunkt bezog sich auf die ewige Produktivitätsteigerung des kapitalistischen Systems, die nicht infrage gestellt würde. Es handele sich nämlich zum einen um ein System der Ausbeutung, diesbezüglich zum anderen hinterfragt werden müsse, was und wie viel überhaupt produziert werde. Dabei gehe es um die grundsätzliche Frage eines ökologisch nachhaltigen Umgangs mit den Ressourcen, außerdem geschehe die Profitmaximierung zu Lasten der Einkommen der Beschäftigten. In diesem Zusammenhang wurde im Kontext von »Anders arbeiten oder gar nicht« die Umverteilung von Arbeit und die alte gewerkschaftliche Forderung der Arbeitszeitverkürzung ins Blickfeld gerückt.
Im Juni 2003 organisierten wir in Berlin-Kreuzberg die Veranstaltung »Terror der Arbeit« mit Guillaume Paoli und Harald Rein. Der Saal war zum Bersten gefüllt, entsprechend der breiten sozialen Bewegung der Zeit; die Hartz-IV-Proteste waren in vollem Gange. Zu Anfang Juli 2004, also vor dem Höhepunkt der »Montagsdemos« und ein halbes Jahr vor der Einführung von Hartz IV, wurde unübersehbar, wohin diese Proteste und Debatten drifteten: Zum einen in einen Parteiaufbau, es gründete sich der Verein »Arbeit & soziale Gerechtigkeit – Die Wahlalternative« (WASG), der sich später mit der PDS zur Partei Die Linke vereinigen würde. Zum anderen bildete sich das Netzwerk Grundeinkommen, in dem außerparlamentarische Gruppen zusammenarbeiteten.
Von nun an drehte sich die Diskussion hauptsächlich um das Konzept des Grundeinkommens – welches ja lediglich im nationalen Rahmen verteilt werden soll und insofern etwa keinen Ansatzpunkt für internationalistische Politik bietet. Und dass es mit der Verteilung von Geld allein ohnehin nicht getan ist, sagen mir auch meine langjährigen Erfahrungen mit Marginalisierten.
Weg vom Lohnarbeitszwang
Natürlich geht es für alle diejenigen ohne Lohnarbeit – und zunehmend auch für Beschäftigte – weiterhin auch um die existenzielle Frage: Wovon leben, wie überleben? Der Staat sorgt dafür, dass diese Menschen in einer Krisensituation gehalten werden: durch Schikanen der Ämter, einen niedrig gehaltenen Regelsatz für das »Existenzminimum« sowie Sanktionen beim Bürgergeld und die Stigmatisierung von Erwerbslosen in der Öffentlichkeit. Praktisch gelebte Lohnarbeitskritik ist daher nur sehr schwierig umzusetzen. Der erwähnte Fachkräftemangel, der übrigens auch durch niedrige Löhne und schlechte Arbeitsbedingungen ausgelöst wurde, setzt Menschen moralisch unter Druck, sich dem kapitalistischen Arbeitsregime zu unterwerfen. Dabei wollen viele einfach von der Produktionsmaschinerie in Ruhe gelassen werden – in einer Zeit oft sinnlosen Produktivitäts- und Konsumwahns.
Und gerade wenn sich die Bedingungen immer weiter verschlechtern, bleibt die Aufgabe dieselbe, die wir schon in den 90ern formuliert haben: Wir müssen weg vom Zwang zur Lohnarbeit, von den vielen »Bullshit«- und Billig-Jobs hin zu einer anderen, besseren Welt ohne Profitmaximierung und Wachstumslogik. Das Motto lautet: Zeitwohlstand für alle!
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.