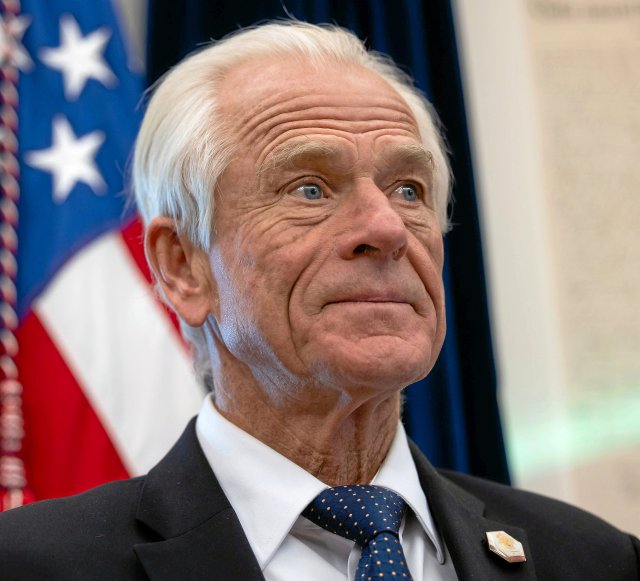Mit Musik auf Seelenfang
Die rechte Szene der USA verbreitet ihre Botschaft über Hasslieder - auch der Schütze von Wisconsin war Sänger
Es war wie so oft nach der Bluttat eines Wahnsinnigen. Die Nachbarn und Bekannten des Täters zeigten sich »schockiert«. Wade Page, der sechsfache Mörder von Milwaukee soll »still, freundlich und unauffällig« gewesen sein.
Leute, die mit der finsteren Skinhead- und Nazi-Punk-Szene in den USA vertraut sind, waren allerdings alles andere als überrascht, als sie hörten, dass Page Anfang August wahllos in einem Sikh Tempel um sich geschossen hatte. Er war so etwas wie ein Star in der rechten Szene, seine beiden Bands, die »Blue Eyed Devils« und »End of Apathy« hatten eine gewisse Popularität erreicht. Noch Anfang Juni spielten beide bei einem regionalen Festival der »Hammerskin Nation« - eine der größten neo-nazistischen Vereinigung der USA. Page schrie Dinge ins Mikrofon wie »Du bist tot Du Scheiß Nigger, ich schieß Dir den Arsch voll mit Blei.« Freundlich und unauffällig war das nicht.
»Diese Musik ist sehr zentral für die Neonazis, sie durchdringt jeden Aspekt der Bewegung«, sagt der Soziologe Peter Simi, der den Rechtsextremismus in den USA erforscht. Dabei ginge es nicht nur darum, Hass und Gewalt zu verbreiten, sondern vor allem auch Macht, Stolz, Selbstachtung und Gemeinschaft zu vermitteln.
Man kennt das von der europäischen »Oi«-Szene, die zu Beginn der 80er Jahre über den Atlantik schwappte und in den USA eine rasant wachsende Neo-Nazi-Bewegung befeuerte. Schon Ende der 80er Jahre tauchten in Texas und Tennessee Hammerskin-Gruppen auf, deren Name sich auf eine Szene des Films »Pink Floyd The Wall« bezieht. Darin ruft ein neofaschistischer Sänger zur Gewalt gegen Minderheiten auf. Die Fans bewegen sich daraufhin in der Form einer Hammerzange auf die Bühne zu.
Die etablierten faschistischen Organisationen in den USA versuchten von Anfang an, diese Szene an sich zu binden. Doch die ersten Anläufe scheiterten kläglich. Die Skins hatten wenig Interesse an politischer Organisation, sie wollten vor allem eines: Gewalt.
So gingen in den 80er Jahren Dutzende von grausamen Morden an Afroamerikanern und Homosexuellen auf ihr Konto. 1997 erschossen sie auch einen Polizisten. Die Hammerskins, denen allem Anschein nach auch Wade Page angehörte, bildeten bald ihre eigene nationale und später sogar internationale Organisation. Sie hatten ein Hochglanzmagazin, einen Internetauftritt, einen Plattenverlag und ein jährliches Festival. Ende der 90er Jahre begann die Skinheadbewegung zu zersplittern, die Hammerskins verloren an Bedeutung.
Zur selben Zeit gelang es den Neo-Nazi-Organisationen, an die Skin- und Oi-Musikbewegung anzudocken. Die National Alliance (NA) kaufte 1999 den Plattenverlag »Resistance Records« und baute ihn zu einem Multimillionen-Dollar-Imperium aus. »Die Musik wurde sowohl zum wichtigsten Rekrutierungsinstrument als auch zur wichtigsten Einnahmequelle der Bewegung«, sagte David Burghardt, Sprecher einer Überwachungsorganisation für radikale Gruppen in den USA, der »New York Times«.
Begünstigt wurde der Erfolg von »Resistance Records« und anderen durch die Gesetzgebung in den USA. Das Verfassungsrecht auf freie Meinungsäußerung macht es dort schwierig, rechtsradikale Hassmusik zu verbieten. Durch die Verbote in vielen europäischen Ländern wanderten die Produktion und der Vertrieb immer stärker in die USA.
Laut dem Southern Poverty Law Center (SPLC), einer halbstaatlichen Organisation zur Extremismusbekämpfung, ist die Szene heute unübersichtlicher als je zuvor. Das liegt nicht zuletzt am Internet, das es ermöglicht, Musik und Propaganda dezentral zu vertreiben.
An Bedeutung hat die Szene deshalb nicht eingebüßt. Im Gegenteil: Laut SPLC ist die Zahl der rechtsextremen Hassgruppen seit der Wahl von Obama von 824 auf 1274 gewachsen. Die meisten von ihnen rocken zu Liedern von Gruppen wie »End of Apathy« von dem Todesschützen Page.
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.