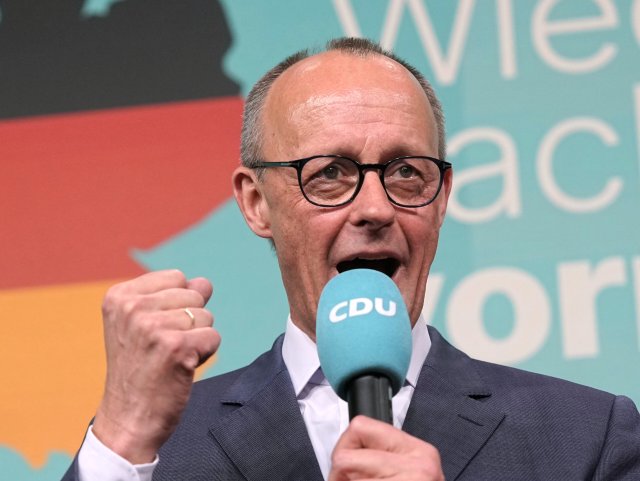PEENEMÜNDE - und noch kein Ende
Zu Beginn voriger Woche öffnete im Bonner Rathaus eine Ausstellung. Sie erinnert: Am 18. Oktober 1944, zwischen 11.00 Uhr und 11.06 Uhr, entledigten sich britische Bomber ihrer Last. Resultat: 300 Tote, 1 000 Verwundete, 20 000 Obdachlose. Das Alte Rathaus, die Universität, die Kreuzkirche, der Boeselagerhof, das Stadttheater, die Beethovenhalle, die Remigiuskirche waren getroffen oder ein Raub der Flammen. Daß die Engänder gerade Bonn angriffen, war ihrem Forschergeist zuzuordnen. Sie probierten GH-Geräte, eine neue Radartechnik, aus und
brauchten - um die Wirkung so erzielter Bombentreffer exakter festzustellen -eine bis dahin weitgehend heile Stadt. Im Begleittext zur Exposition heißt es: „Das scheinbar lokale Ereignis enthüllt mit seinen Abläufen und Zufälligkeiten die Kälte und Grausamkeit einer Kriegsmaschinerie, der Gefühle oder gar Rücksichtnahmen fremd sind. Ihre lediglich auf Erfolg getrimmte Handlungsweise scheut die Zerstörung von Kulturgütern, den Tod und Schmerz tausender Menschen nicht. Das Beispiel Bonn ist dafür sehr aufschlußreich.“
Für die Art und Weise, wie man eigene „Kälte und Grausamkeit“ darstellt, ist das Beispiel Peenemünde sehr aufschlußreich. Das Nest liegt hunderte Kilometer entfernt vom Regierungssitz auf der Insel Usedom. Hier zimmerten erfolgsgetrimmte deutsche Wissenschaftler zwischen April 1936 und Mai 1945 Hitlers „Vergeltungswaffen“. Auf dem Areal der einstigen Heeresversuchsanstalt soll ein Weltraumpark entstehen.
Über die ebenso unendliche wie unerträgliche Peenemünder Geschichte berichtet RENE HEI-
Nach Ziolkowski, einem Russen, und Goddard, einem Amerikaner, verfolgten vor allem deutsche Wissenschaftler die Idee des Raketenantriebes. Bereits 1917, so wird berichtet, habe ein Jüngling namens Hermann Oberth dem deutschen Generalstab die kriegsmäßige Verwendung solcher Flugkörper angeraten. Die Reichswehr baute das Artillerie-Versuchsgelände Kummersdorf-West zu einem Testzentrum für Raketen aus. Ein Hauptmann Walter Dornberger, Chef der Wa Prüf 11, später Major, leitete bis zum Kriegsende die Raketenforschung. Er sammelte junge Techniker um sich, schuf ihnen Freiräume der Kreativität, machte Geld locker und ließ im Dezember 1934 „Max“ und „Moritz“ als Aggregat 1 von der Rampe.
Zwei Jahre später zog man in den Peenemünder Sperrbezirk. Als die Faschisten in Polen einfielen, arbeiteten schon 300 Mann unter Dornberger. Bald beteiligte sich jeder dritte Forscher des Reiches am Wunderwaffenprogramm. Am 3. Oktober 1942 waren sie sicher- das Aggregat 4 flog. Noch parallel zur pommerschen Küste, 192 Kilometer weit.
Es ist schon ein starkes Stück, wenn man angesichts der Tatsachen versucht, dieses Datum und die vorangegangenen zwölf Entwicklungsjahre zum Beginn der Kosmosforschung umzudeuten und Peenemünde zur „Wiege der Raumfahrt“ zu erklären. Doch genau das geschieht. Systematisch. Dabei war es den Protagonisten dieser Lüge willkommen, daß die Amerikaner kein Wort zuviel über ihre Aktion „Paperclip“ verloren. Unter diesem Code lief nach 1945 eine Geheimoperation zur „Übernahme“ der deutschen Raketenspezialisten. In den USA verschossen sie V 2-Restbestände und bastelten dann die atomar bestückte Redsto-
ne-Rakete. Wie der Codename der sowjetischen Operation hieß, mit der die menschlichen und technischen Reste deutscher Raketenentwicklung zusammengeklaubt und nach Kasachstan verfrachtet wurden, ist nicht bekannt. Sicher ist nur, daß die ersten sowjetischen Atomraketen der Redstone verdammt ähnlich waren. Die SS 20, die Pershing sowie die so gefürchteten Scud-Raketen sind deren Enkel.
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.