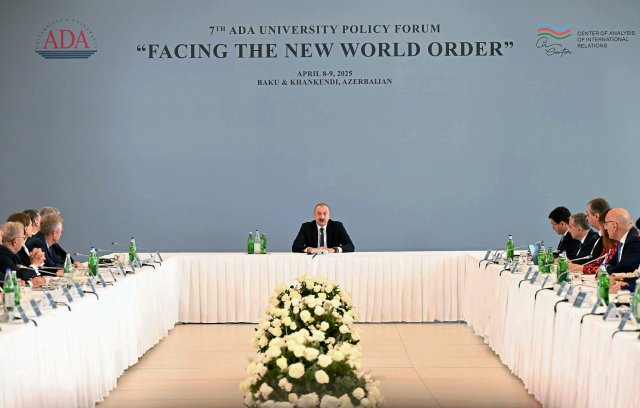- Politik
- Ein Star wird 40 Jahre alt : Rückblick auf seine DDR-Vergangenheit
Unser Sandmännchen
das Menschlein unter den Puppen
Foto: privat
Kinder, Eltern, Großeltern und Menschen überhaupt wird. In zeitlos lieber Kostümierung und unbeirrt sprachlos stakst das überirdische Wesen jeden Abend via Bildschirm in die Wohnungen vieler Ost- und einiger Westdeutscher. Nach relativ kurzer Zeit bestimmt eine Puppe von 25 Zentimetern Höhe, die ewig das Gleiche singt, die Abendbrot- und Schlafenszeiten deutscher Familien. Viele haben noch keinen Fernsehapparat, so dass sich Guckgemeinschaften bei Nachbars bilden. Die Sendungen werden aufmerksam verfolgt; die damals noch kleine Redaktion ist der massenhaften Anteilnahme, die sich in Hinweisen, aber auch Forderungen ausdrückt, kaum gewachsen. Fernsehen ist in diesen Zeiten etwas ganz Besonderes und als die Westkonkurrenz in Gestalt eines opahaften Flugwesens endlich ausgeschlafen hat und auf der Bildfläche erscheint, sind zwei Jahre vergangen. Da hat der Ostknabe schon eine gewaltige Fangemeinde. Mutig geworden durch seine Unantastbarkeit macht er sich gerade daran, sein Imperium auszuweiten.
Szenenbildner Harald Serowski kommt ein Jahr nach der Geburt des Champions in das Team. Er ist inzwischen berühmt für seine vielen Fahrzeuge, die er dem kleinen Wicht mit den Kugellagern in den Gelenken während ihrer 30 Jahre andauernden direkten Beziehung auf den Leib bastelt. Maßstabgerechte Zeichnungen von Gebäuden, Gefährten, Gegenden aus seinen Händen sind wohl auch ein Grund für die perfekte Harmonie, die die 35-Millimeter-Filme ausstrahlen. Es kommt dem Zuschauer ganz normal vor, wenn Sandmännchen in den Trabi oder die Rakete steigt, mit einem Mondmobil davon rauscht, die Draisine sanft über die Gleise schiebt, Mäuse in der Kürbiskutsche herumfährt, mit dem fliegenden Teppich über allem schwebt, Drachengleiter hervorholt, einfach mal das Fahrrad nimmt oder den Panzer anhält. Alles ist möglich. Dass Serowski in einer seiner berühmten Fahrzeugausstellungen in bundesdeutscher Gegenwart kleine DDR-Embleme von Sandmann-Flugzeugen kratzen muss, sagt einiges über den Geist des Anklamer Kulturfunktionärs, der es verlangte.
Serowski schreibt viele Rahmenhandlungen selbst, weil er die Fortbewegungsart bereits im Kopf hat. Das Interesse der Kinder für die Ausstellungen gibt ihm Recht. Bis heute verfolgt er in seinem Schaukelstuhl mit dem Lederschild, auf dem NPT für Nationalpreisträger steht,
den Abendgruß. Mitunter skeptisch, wenn er die wenigen neuen Filme betrachtet, in denen sein alter Freund nun manchmal herumhopst wie ein Irrwisch. Mitunter voller Rührung, denn es ist sein Leben, was da an ihm vorüberflimmert. An jedem alten Streifen hängt eine Geschichte. Eine von den bekannten komischen ist die von der Fahrt im Heißluftballon. Ausgerechnet an dem Tag, als eine Familie aus der DDR tatsächlich auf so abenteuerliche Weise über die Grenze in den Westen flüchtet, kommt der Schlafbringer des Ostens auch mit einem Ballon. »Sandmännchen wie immer ganz aktuell«, hört Serowski abends im Radio den Rias frotzeln. Der heiße Vor-und-Abspann kommt auf den Index.
Die Sandmannmacher werden nicht nur mit Briefen und den immer wiederkehrenden Fragen überschüttet, wo der Sandmann denn nun wohne, warum er keine Frau habe und wo der Schlafsand eigentlich herkommt, sondern auch mit Ehrungen und Auszeichnungen. Banner der Arbeit werden an sie gereicht; Goldene Lorbeere, Kunst- und Nationalpreise. Wolfgang Richter hat in seinem Schrank zwei Nationalpreise, unterschrieben von Walter Ulbricht und Erich Honecker. Dazu legt er 1979 einen Brief vom Papst, der seit seiner Krakauer Zeit als Erzbischof Liebhaber des Sandmännchens, insbesondere des dazugehörigen Liedes, ist. Seit Mitte der 90er Jahre kann sich der Pontifex diesem Genuss nicht mehr hingeben, weil die Heilige Messe zeitlich verlegt wird. Die Kunde gelangt nach Berlin, und der Atheist Richter schickt ein Video mit Sandmannfilm und -lied an den Vatikan. Monsignore Harvey übermittelt ihm daraufhin den aufrichtigen Dank des Heiligen Vaters. »Von Herzen erbittet seine Heiligkeit Ihnen und allen, die Ihnen nahestehen. Gottes freien Schutz und Beistand«.
Die eigentlichen Geschichten erzählt der Abendgruß, vom Besuch des Sandmännchens eingerahmt. Seit 1969 wird die Sendung in Farbe ausgestrahlt und zusätzlich im 2. Programm des Fernsehens. Kaum ein Mensch in der DDR, der nicht Herrn Fuchs und Frau Elster kennt, denen Heinz Schröder und Heinz Fülfe Stimme und Bewegung gaben. Unvergesslich für »Klein« und in diesem Falle auch »Groß«, wie der Fuchs seinem Eifer mit der Wortschöpfung »Hassassas« Ausdruck verleiht und mit »Kreuzspinne und Kreuzschnabel« über seine gefiederte vorlaute Freundin schimpft. Zu den Favoriten der Kinder gehören auch Heinz Schröders Pitti-
platsch, Friedgard Kurzes Schnatterinchen und zahlreiche andere Hand-, Trickfilm- und Flachfigurenpuppen. Später kommen Realfilme wie der Liederspielplatz oder die Elternporträts dazu. Der von Heinz Fülfe - er stirbt 1994 - erfundene Taddeus Punkt zeigt, wie man aus einer 10 einen Fernsehapparat zeichnet. Frau Puppendoktor Pille verhilft einer Puppe mittels Lineal zum aufrechten Gang, »denn wer den Kopf hoch trägt, sieht mehr als der, der ihn niederschlägt«. Ein Dokumentarfilm zeigt den real existierenden Vati der real existierenden Katrin: »Er ist Tankwart. Seine Tankstelle ist an einer wichtigen Straße«. Rolf und Reni erklären, warum man nicht so dicht an den Fernseher gehen darf. Auf dem Liederspielplatz singen Kinder alte und neue Lieder, auch »für die Kinder der Welt«. Der pädagogische Zeigefinger ist nicht zu übersehen. Kolleginnen und Kollegen aus anderen Bereichen des Kinderfernsehens rümpfen die Nase angesichts der speziellen Sandmann-Ästhetik und deren brutaler Verknüpfung mit den vollkommen unterschiedlichen Genres der Abendgrüße, die sie einrahmen. Das hindert später einige von ihnen nicht, zu den Sandmannfreunden zu konvertieren, als genau diese umstrittene Sendung als einzige die Abwicklung des DFF zu überleben scheint.
In den 80er Jahren drängen neue Fantasiewelten die alten Belehrungsfilme in den Hintergrund. Fabelwesen wie der Wasserkobold Plumps treten ins Bild - erdacht von der langjährigen Pittiplatsch-Autorin und Bilderbuchschreiberin Ingeborg Feustel.Sie stirbt 1998. Es gibt Versuche, der veränderten Lebenswelt der Kinder mit den Sängern Ulf und Zwulf zu entsprechen. Kistenweise werden nach den ersten Sendungen Briefe in die Redaktion geschleppt. Die Zuschauer.- bzw. deren schreibende Eltern - vermissen den jahrelang am Freitag ausgestrahlten Liederspielplatz. Und ein Sänger trug einen Ring im Ohr. Dabei hatte es schon Schlimmeres gegeben.
Eines Abends schaut sich Sachbearbeiterin Inge Riese, die über 20 Jahre Sandmannfilme und Abendgrüße sortiert, kontrolliert, angeschaut, zusammengefügt hat, die Sendung an. Nachdem Sandmännchen den Abendgruß angekündigt hat, erscheint ein kopfstehender Pittiplatsch, der kauderwelschartige Töne von sich gibt. Filme falsch zusammengeklebt, konstatiert die Frau entsetzt. Während das Pausenbild erscheint, und schnell der für den nächsten Tag vorbereitete Film
eingelegt wird, macht sie sich auf den Weg in den »Sender«, um die Sache in Ordnung zu bringen. Es ist nicht das einzige Mal, dass sie das tun muss. Als zum Ende der Weltfestspiele 1973 Walter Ulbrichts Tod bekannt gegeben wird, ruft man alle Kinderfernsehchefs am Wochende in die Redaktion. Für Trauerfälle gibt es einen Sandmann-Vor-und-Abspann ohne Lied. Man findet es pietätlos, den Knopfäugigen an einem solchen Tag singen zu lassen, dass es ihm Spaß gemacht hätte. Nun muss für den Fall Ulbricht noch ein Abendgruß gefunden werden, welcher nicht allzu lustig daher kommt. Ein eigens angefertigter Schwarz-Weiß-Film, in dem ein Schauspieler mit todernster Mine ein trauriges Gedicht vorliest, wird verworfen. »Gott sei Dank«, erinnert sich die Sachbearbeiterin. »Der sah ja aus wie ein Gespenst«. Man entschließt sich wohl für ein Konzert, und Riese fügt zusammen, was zusammengehört. An viele unliebsame Zwischenfälle kann sie sich nicht erinnern, aber »an eine schöne und interessante Zeit«, in der höchstens mal ein Film vom Sender genommen wird, weil so viele Linsenbüchsen im Regal stehen und die Zuschauer aus der Republik beleidigt reagieren, weil die Hauptstadt - wie man in Sandmanns Elternporträt sehen konnte offensichtlich wieder bevorzugt war.
Der Deutsche Fernsehfunk wird 1991 aufgelöst, der bayerische Abwickler Rudolf Mühlfenzl gerät zwar angesichts des lieben Sandmännchens und der schönen Beine der Ballett-Damen in eine weichherzige Stimmung und möchte sich und dem gesamtdeutschen Fernsehpublikum beide Anblicke erhalten. Doch dass das Sandmännchen heute in ORB, MDR, NDR, SFB und dem Kinderkanal über den Sender geht und täglich 2,5 Millionen Zuschauer hat, dürfte eher an einer Protestwelle liegen, die ein Westberliner Zuschauer angesichts der drohenden Abwicklung initiiert, und die in den Norden überschwappt, wo NDR-Intendant Jobst Plog über das beliebte Funkmedium wacht, welches er diesem Ostsandmännchen anfangs nicht überlassen möchte. In Berlin versucht man auf einer eilig einberufenen Konferenz, die friedliche Machtübernahme der ältlichen Ostpuppe zu verhindern. Die damalige Rundfunkratsvorsitzende hält die Installierung einer Erzähloma für eine Superidee. Die Konferenz lehnt geschlossen ab.
So ist uns der kleine Kerl mit der Vier-Finger-Hand - fünf hätten sich nicht mehr bewegen lassen - und dem Sandsäckchen erhalten geblieben. Viel mehr als ein paar Besuche in den realsozialistischen Neubaugebieten, die eine oder andere Fahrt im NVA-Panzer sowie ein paar Flüge in der russischen Rakete kann man ihm nicht vorwerfen. Die Kinder lieben ihn und sein ganzes wunderliches Gefolge, auch wenn er ihnen mit dem Terror vom Händewaschen kommt und sich jedem Gespräch verweigert. Vielleicht ist es sein Glück, dass er stumm blieb, so konnte er niemals dummes Zeug erzählen. Sein Geheimnis, meint Behrendt, ist die Reduzierung auf das Wesentliche. Für die langjährige Abendgruß-Regisseurin Brigitte Natusch besteht der Zauber in der untadeligen und sauberen Physiognomie. Äuglein und Nase - ganz so wie jedes kleine Menschlein am Anfang des Lebens aussieht.
Dass Sandmännchen mit 40 Jahren noch nicht am Ende seines Streuens angekommen ist, scheint sicher. Die Fangemeinde freut sich über neue Sandmann-Filme. Urheber Gerhard Behrendt freut sich, dass er als Berater für die eine oder andere neue Produktion gehört wird. Wolfgang Richter wehrt sich gegen allzu freche Aneignungen seines Liedes mitunter auch per Anwalt. Harald Serowski arbeitet gelegentlich an einer Ausstellung mit. Von den über 40 Mitarbeitern des Trickfilmstudios werden nur noch wenige für ein paar Wochen im Jahr zur Herstellung einiger neuer Filme benötigt. Welch ein Glück für die kleinen und großen Liebhaber, dass es so viele alte in der Konserve gibt. Sandmännchen lebt. Gratulation!
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.