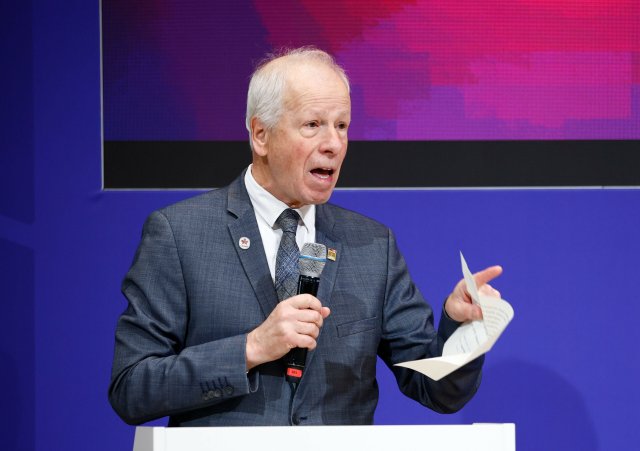Millionen zur Zwangsarbeit verpflichtet
Unhaltbare Zustände in der Baumwollindustrie Usbekistans - auch Deutschland profitiert davon
»Papa, erzähl mir eine Geschichte, aber eine gruselige«, sagt das blonde Mädchen. So beginnt der Kurzfilm »Cotton Dreams«, der seit einigen Tagen im Internet kursiert. Er ist das Zugpferd der aktuellen Kampagne von Inkota und dem European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR), mit der sie auf unhaltbare Zustände in der usbekischen Baumwollindus-trie hinweisen wollen. Der böse Präsident, der seine Untertanen zur Sklavenarbeit auf den Feldern zwingt - er existiert nicht nur im Märchen.
Usbekistan ist der viertgrößte Baumwollproduzent weltweit. Jedes Jahr verpflichtet die Regierung die Einwohner, um die riesigen Felder abzuernten, letztes Jahr waren es 2,5 Millionen Menschen. Sie müssen für die Arbeit ihre Familien, ihren Wohnort und ihren Beruf verlassen, zwei Monate dauert ein Einsatz üblicherweise. Untergebracht sind die Zwangsarbeiter in Baracken und Scheunen, teilen sich den Platz mit dutzend anderen. »Sie werden nicht bezahlt und müssen während der Zeit für ihr Essen selbst aufkommen«, erzählt Umida Niyazova, Vorsitzende des Usbekisch-Deutschen Forums für Menschenrechte (UGF). Das bedeute: Sie müssen mindestens 30 Kilo am Tag ernten, um wenigstens zwei kleine Mahlzeiten zu erhalten. Am Ende seien viele verschuldet. Lehrer, Beamte und andere öffentliche Angestellte landen in der Arbeitslagern. »Es wurde schon ein ganzes Krankenhaus mit Ärzten und Krankenschwestern eingezogen«, sagt Claire Tixeire vom ECCHR. Die Bevölkerung in der Gegend habe dann monatelang keine medizinische Versorgung gehabt. Das Schlimmste aber: Die meisten der Zwangsarbeiter sind Kinder zwischen 9 und 14 Jahren.
UGF ist die einzige Organisation, die noch Kontakt zu den Zwangsarbeitern hat. Usbekistan hat fast alle NGO des Landes verwiesen, die Diktatur will keine Einmischung. »Wir reden hier nicht über kulturelle Unterschiede sondern über systematische, staatlich organisierte Zwangsarbeit«, meint Tixeire. »Der einzige Weg ist deshalb der vollständige Boykott usbekischer Baumwolle.« Die Baumwolle aus Kinder- und Zwangsarbeit landet hauptsächlich in Europa und damit auch Deutschland. Dort profitiert man von den günstigen Einkaufspreisen. »In den letzten 30 Jahren hat sich der Preis für ein Kilo Baumwolle halbiert«, sagt Bernd Hintzmann von Inkota. Gefragt seien nicht nur Hersteller und Verbraucher, sondern auch die Politik. »Wir sollten nicht nur wie bisher über Farb- und manche Giftstoffe in den Produkten informiert werden, sondern auch darüber, unter welchen Bedingungen sie hergestellt wurden.« Veränderung könne nur gelingen, wenn alle die herrschende »Billig-Billig-Mentalität« aufgäben. Zurzeit läuft in Berlin die Fashion Week. Dort veranstalten die Organisationen jetzt Diskussionen und Protestaktionen. Modelabels und Textilhersteller sollen sich verpflichten, nur »saubere« Baumwolle zu verwenden.
Informationen und Video unter www.ecchr.eu/baumwolle
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.