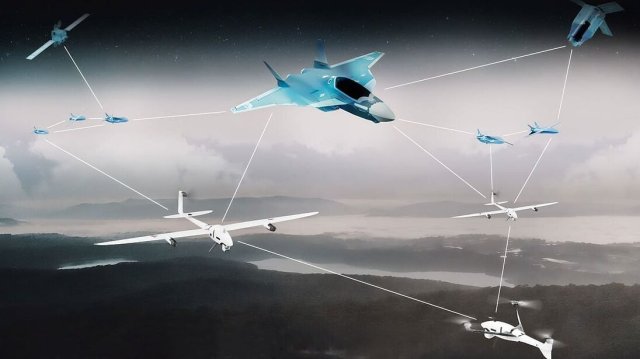Leben in feindlicher Umgebung
Wenn Geflüchtete aus Angst vor Anfeindungen ihr Lager nicht verlassen - ein Beispiel aus Mecklenburg-Vorpommern
Schüchtern stehen einige Geflüchtete bei der Ankunft der Journalisten vor der Tür des Gemeinschaftswohnheims in Anklam, in sicherer Entfernung zu dem umzäunten Eingang. Das Heim befindet sich etwas außerhalb des Zentrums der Stadt im Osten von Mecklenburg-Vorpommern. Rassismus und Rechtextremismus gehören hier zum Alltag der Geflüchteten.
Tifsa, ein junger Mann aus Eritrea, lebt seit drei Monaten hier. »In the Heim, no Problem«, erzählt er, »aber das Verhalten der Menschen außerhalb des Heims ist nicht okay. Wenn du ›Hallo‹ zu ihnen sagst, antworten sie nicht. Sie sprechen nicht mit uns, insbesondere nicht mit Schwarzen.« Er und seine Freunde verlassen das Heim so gut wie nie. »Regelmäßig werden hier Geflüchtete beleidigt und mit Gesten wie etwa dem Zeigen des Mittelfingers oder gar dem Werfen von faulem Obst bedroht«, erzählt eine Mitarbeiterin des Vereins LOBBI, der in Mecklenburg-Vorpommern Betroffene rechter Gewalt berät. Rechte Gruppierungen und Parteien haben hier nicht nur starken Zulauf, sie besitzen auch Geschäfte, Grundstücke und Felder. »In Anklam gehören der Neonaziszene der Pommersche Buchladen, die alte Bäckerei und zahlreiche Immobilien«, erklärt eine Mitarbeiterin der Amadeu-Antonio-Stiftung, die im Oktober eine Journalistenreise zu mehreren Heimen in Mecklenburg organisierte und in der Region Projekte gegen Rechtsextremismus und Rassismus fördert. Mit ökologischen Anbaukonzepten und Kinderfesten gewinnen rechtsextreme Gruppen die Sympathie der Bevölkerung.
Ein besonders unsicherer Ort für Geflüchtete ist der Bahnhof in Anklam. Bürgerinitiativen berichten, dass sich hier regelmäßig fremdenfeindliche und rechtsextreme Jugendliche treffen. Am Abend des 10. November werden drei Bewohner des Asylbewerberheims Anklam aus Afghanistan und Iran nach ihrer Ankunft am Bahnhof von acht jungen Frauen und Männern beschimpft und beleidigt. Dann schlagen die Angreifer auf die drei Männer ein, einer zückt ein Messer.
Die Angegriffenen flüchten Richtung Asylbewerberheim. Als die Angreifer außer Sichtweite sind, entscheidet sich einer der beiden Afghanen, die zurückgelassenen Fahrräder zu holen. Beim Überqueren des Parkplatzes am Ärztehaus fährt ein Pkw mehrmals auf ihn zu, so dass er sich nur durch einen Sprung zur Seite retten kann. Als die Polizei die Flüchtlinge im Asylbewerberheim aufsucht, stellt sie Verletzungen fest, die eine ärztliche Behandlung notwendig machen. Daraufhin werden sie in das örtliche Krankenhaus gebracht. »Seitdem haben die Geflüchteten große Angst und Schwierigkeiten, den Übergriff zu verarbeiten«, berichtet die Mitarbeiterin von LOBBI.
»Eine Horde von Idioten ist das doch. Die schlagen Anklam wirklich ins Gesicht!« reagiert Bürgermeister Michael Galander auf die Nachricht von dem Überfall am Anklamer Bahnhof auf die drei Asylsuchenden. Für die Engagierten in Anklam sei der Übergriff »durch eine rassistische Prügelhorde« ein Schlag ins Gesicht, heißt es im »Nordkurier«. Wieder sei die Stadt kein Beispiel für ein friedliches Miteinander, sondern werde als brauner Brennpunkt in Vorpommern stigmatisiert.
Wenige Tage später wird einer der Betroffenen beim Einkaufen erneut rassistisch beschimpft. Seitdem verlassen die drei Geflüchteten das Heim gar nicht mehr. Auch zum Fußballspielen trauen sie sich nun nicht mehr hin. »Wenn Menschen wie du und ich in Anklam einfach zusammengeschlagen werden, kann ich das nicht akzeptieren«, kommentiert Roderich Eichel, Jugendsozialarbeiter im Anklamer Jugendclub »Mühlentreff«, den Übergriff. In seinem Jugendclub trainierten Asylbewerber und Anklamer Jugendliche friedlich miteinander. Eichel will nun eine gemeinsame Sportgruppe aus Anklamer Jugendlichen und jungen Asylsuchenden ins Leben rufen.
Einige der acht Tatverdächtigen, die die Polizei inzwischen ermittelt und verhört hat, seien bereits vorbestraft gewesen, erklärt Andreas Scholz, Sprecher des Polizeipräsidiums in Neubrandenburg, gegenüber »nd«. Erschreckend ist, dass bei dem Angriff neben den erwachsenen Schlägern auch Jugendliche im Alter von 13 und 14 Jahren und sogar ein Kind dabei gewesen sein sollen. Die Polizei geht davon aus, dass diese zwar nicht aktiv auf die Asylsuchenden eingeprügelt, aber auch nichts gegen die Tat unternommen haben. Scholz zufolge handelt es sich um eine fremdenfeindliche Tat. Es gebe aber bisher keine Erkenntnisse darüber, dass die Tatverdächtigen dem rechtsextremen Spektrum zuzuordnen seien, so der Polizeisprecher. Der Staatsschutz ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.
In dem leeren Bahnhofsgebäude von Anklam will Michael Steiger ein selbstverwaltetes Jugendzentrum aufbauen. »Wir haben irgendwann festgestellt, dass ein Zentrum, in dem die Jugendlichen sich selbst verwirklichen können, hier fehlt«, erzählt Steiger, der mit dem Pfadfinderbund in Anklam zusammenarbeitet. Vor einem Jahr mietete der Moderator für Jugendbeteiligung das leerstehende Bahnhofgebäude an. Seitdem befindet sich sein Projekt »Demokratiebahnhof« im Aufbau, bei dem Jugendliche aus Anklam an Stadtentwicklungsprozessen mitwirken sollen. Junge Akteure eines selbstverwalteten Jugendzentrums in Greifswald sollen sie darin unterstützen, hier einen demokratischen Ort aufzubauen. Langfristig sollen autarke Jugendprojekte und kulturelle Jugendstrukturen in Anklam entstehen.
Wenig Freizeit- und Gestaltungsmöglichkeiten, aber genügend leer stehenden Wohnraum gibt es auf dem flachen Land in Mecklenburg. Aus Zahlen des Statistischen Amtes Mecklenburg-Vorpommern geht hervor, dass 6,2 Prozent des verfügbaren Wohnraums hier leer stehen. »Gerade in Mecklenburg-Vorpommern halte ich die Diskussion über die zunehmende Zahl an Flüchtlingen für vollkommen überflüssig, weil wir hier sehr viel leer stehenden Wohnraum haben«, kommentiert Ulrike Seemann-Katz, Sprecherin des Flüchtlingsrates Mecklenburg-Vorpommern, die Debatte über steigende Zahlen von Asylsuchenden im Zusammenhang mit ihrer Unterbringung. »Es wird immer gesagt, dass jetzt neue Flüchtlingsströme kommen, dass sehr viele kommen werden. Das ist gefährlich, so zu diskutieren.« Natürlich sei es nicht einfach, von heute auf morgen eine Gruppe von Geflüchteten unterzubringen. Sie sei aber überzeugt davon, dass die Gemeinden das schaffen könnten.
Der Flüchtlingsrat fordert, dass Landkreise und Kommunen zügiger als bisher Wohnraum für Menschen organisieren, die aus Krisen- und Kriegsgebieten nach Deutschland flüchten und nach Mecklenburg verteilt werden. Angesichts des Leerstands von Gebäuden erscheint es absurd, dass in einigen Landkreisen, wie etwa in Vorpommern-Rügen, bereits darüber nachgedacht wird, Wohncontainer für Asylsuchende aufzustellen.
In Anklam, das zum Landkreis Vorpommern-Greifswald gehört, leben derzeit etwa 750 Flüchtlinge in vier Gemeinschaftsunterkünften und dezentralen Wohnungen. Bis zum Jahresende sollen hier laut dem Leiter des Sozialamtes in Pasewalk, Gerd Hamm, weitere 500 Menschen untergebracht werden. Bei einem Treffen mit Geflüchteten der Gemeinschaftsunterkunft in Anklam im Stadtteilbüro des Arbeiter-Samariter-Bundes berichtet Ulrike Reimann von der Caritas von Schwierigkeiten bei der Suche nach geeigneten Objekten und Wohnungen: »Jede Woche bekomme ich 20-25 Flüchtlinge zugewiesen. Dann fahre ich im Landkreis rum und suche was.«
Vor anderthalb Wochen habe sie sich eine Jugendherberge an der Ostsee angeguckt, nach ihrem Gespräch sei der Betreiber aber abgesprungen. »Wir haben hier sehr viel leerstehenden Wohnraum, aber ich kann ja niemanden zwingen, dem Landkreis Häuser und Wohnungen zur Verfügung zu stellen.« Sie zuckt mit den Schultern. »Und wissen Sie, was eigentlich unsere Problematik ist? Die Leute, die aus den Gemeinschafts- und den dezentralen Unterkünften ausziehen müssen, wenn sie Aufenthaltsrecht bekommen. Es ist total schwierig für diese Leute, eine Wohnung zu finden. Was es so schwierig macht? Naja, es ist ja nicht so, dass die Wohnungsgesellschaften hier Hurra schreien, wenn wir anfragen. Es gibt hier sehr viele Nazis. Das ist hier einfach so«, sagt sie, als sei dies das Normalste auf der Welt.
Das Treffen mit den Journalisten bei Kaffee und Kuchen scheint eine der wenigen Gelegenheiten für die Geflüchteten zu sein, mit der Außenwelt in Kontakt zu treten und sich gegenüber Dritten zu öffnen. Bilal aus Syrien bricht in Tränen aus. In seiner Heimat habe er seine Frau und seine Kinder zurückgelassen, und da diese inzwischen auf der Flucht seien, habe er den Kontakt zu ihnen verloren. Er zeigt Fotos von seinen Kindern und wirkt vollkommen verzweifelt. Er wollte an einem Deutschkurs teilnehmen, wurde aber von der Lehrerin nicht zum Unterricht zugelassen, erzählt er. Eine alleinstehende Syrerin mit zwei kleinen Kindern berichtet von einem Übergriff von Rechtsextremen, als sie früh morgens ihre Kinder in den Kindergarten bringen wollte. Zwei junge Männer seien plötzlich vor ihr aufgetaucht. Einer habe mit einem Stück Kreide ein Hakenkreuz neben ihr auf den Asphalt gemalt. Daraufhin sei sie schnell weggelaufen. Schnell weg von hier würden viele der Geflüchteten gerne, denn der Alltag und die täglichen Anfeindungen sind schwer zu ertragen, insbesondere für Menschen wie Bilal, die kriegstraumatisiert sind.
Wie schwierig es in einem rassistischen Umfeld ist, konstruktive Jugendarbeit zu machen, zeigt Michael Steigers Projekt »Demokratiebahnhof«. Im Bahnhof von Anklam sollen täglich Jugendliche mit fremdenfeindlicher Gesinnung rumlungern. Dem Inhaber der Reiseagentur, der Fahrkarten der Deutschen Bahn verkauft und hier einen kleinen Kiosk betreibt, wird nachgesagt, er sei unfreundlich zu Kunden, die nicht aus der Region kommen. Anfeindungen gegen Steigers Projekt gab es schon von verschiedenen Seiten. Dennoch möchte er genau hier ansetzen: »Jetzt müssen wir gucken, dass wir die Leute, die was gestalten wollen und nicht Nazis sind, zu uns kriegen«, sagt er nüchtern. Denn hier gebe es genauso viele Jugendliche, die sich selbst verwirklichen wollten, wie in anderen Regionen, nur gebe es dafür zu wenige Möglichkeiten, ist er überzeugt.
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.