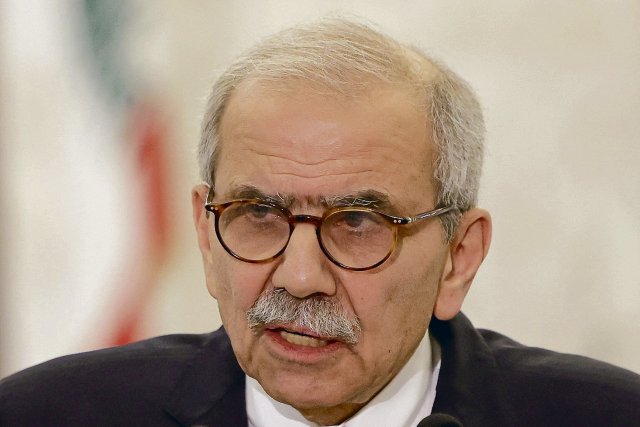Gestrandet in Piräus
Immer mehr Flüchtlinge landen in der griechischen Hafenstadt und wollen weiter - zu ihren Familienangehörigen
Ein Pärchen sonnt sich auf der Kaimauer, zwei Mädchen rennen einer Frisbee-Scheibe hinterher, einige Jungs springen lachend ins Hafenbecken. Man könnte die Szenerie am griechischen Hafen von Piräus auch für die eines Ausflugs am Sonntagnachmittag halten. Doch da sind die eng gestellten Campingzelte, überlaufende Dixi-Klos und langen Schlangen von Menschen, die zu einigen Helfern des Roten Kreuzes führen.
Dort wo normalerweise Schiffe beladen und Fährpassagiere abgefertigt werden, leben nun Hunderte Flüchtlinge - und jeden Tag werden es mehr. Seitdem EU und Türkei im Rahmen ihres Flüchtlingsabkommens beschlossen haben, die Auffanglager auf den griechischen Inseln zu evakuieren, stranden immer mehr Flüchtlinge im Hafen von Piräus, ohne zu wissen, wie es mit ihnen weitergehen soll.
Zwischen zwei Zelten humpelt die 14-jährige Mezgin. Auf der Flucht habe sie sich den Fuß gebrochen, erzählt sie. Die Krücken bekam sie von Helfern auf einer der griechischen Inseln. Eigentlich habe die Familie aus dem syrisch-kurdischen Qamishli nicht vorgehabt, den beschwerlichen Weg über den Balkan zu wagen. »Mein Vater ist schon in Deutschland, er sollte uns nachholen.« Doch die Behörden lehnten die Familienzusammenführung wegen fehlender Papiere ab. Die Hoffnung, mit ihrer Mutter und den beiden Schwestern doch noch zu ihrem Vater zu kommen, hat sie dennoch nicht verloren. »Es ist kalt, wir bekommen nicht genug zu essen, es ist einfach scheiße hier. Wir müssen nach Deutschland.«
Ein paar Meter weiter eine fast identische Geschichte: Im Schatten zweier Lkw sitzen Betul, Iman und Ahland auf dem Asphalt und füllen die Bilder eines Ausmalbuchs. Die 13, acht und sechs Jahre alten Schwestern sind mit ihrem Vater aus der syrischen Stadt Deir Azzur vor der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) geflüchtet. Ihre Mutter habe sich mit zwei weiteren kleineren Geschwistern schon vor einigen Wochen nach Deutschland gerettet, erklärt Vater Mohammed: »Hätten wir auf die deutschen Behörden gewartet, wären wir längst tot.«
Wie Mezgin und Betul geht es vielen im Hafen von Piräus. Kinder sind auf dem Weg zu ihren Eltern, Frauen zu ihren Ehemännern, Väter zu ihrer Familie. Familien wurden durch Krieg und Flucht auseinandergerissen, fast alle haben Verwandte in Deutschland oder anderen westeuropäischen Ländern. Funktioniert hat die behördliche Familienzusammenführung bei niemanden.
Im Fall von Jolana und Mohammed aus Idlib sind es die drei Söhne, die es bereits nach Deutschland geschafft haben. »Ich bin krank, hier gibt es keine Medikamente für mich. Ich will nur noch einmal meine Kinder wiedersehen«, sagt die 54-jährige Jolana. Seit drei Tagen leben sie in einem Warteraum für Fährpassagiere. Überall auf dem Boden liegen Menschen, die nicht viel mehr besitzen als eine Decke mit UNHCR-Aufdruck. Die Luft ist stickig. In der Nähe der Toiletten ist der Gestank kaum erträglich.
Dort sitzt Abdulkarim aus Aleppo mit seinen beiden Kindern auf dem Fliesenboden. Erst nach Idlib, dann nach Homs und schließlich in die Türkei habe seine Flucht geführt. »Nirgendwo war es sicher für uns«, sagt der 44-Jährige. »Meine Kinder sind seit drei Jahren nicht zur Schule gegangen. Warum könnt ihr nicht wenigstens ihnen helfen?« Ein Leben in einem der Lager Griechenlands kann er sich nicht vorstellen: »Die sind doch sowieso schon überfüllt, wir werden immer wieder versuchen, nach Deutschland zu kommen.«
Ähnlich sieht es auch Hammed. Der 14-Jährige aus dem syrischen Idlib steht draußen in der Sonne auf der Kaimauer und starrt regungslos ins Hafenbecken. Aus einem Besenstiel und einem Strick hat er sich eine Angel gebastelt, nun wartet er - nicht nur auf die Fische. Auch er will mit seiner Familie nach Deutschland. Dass die Grenze nach Mazedonien geschlossen ist, hört er zum ersten Mal: »Na dann gehen wir einfach hin und bitten sie, sie wieder aufzumachen.«
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.