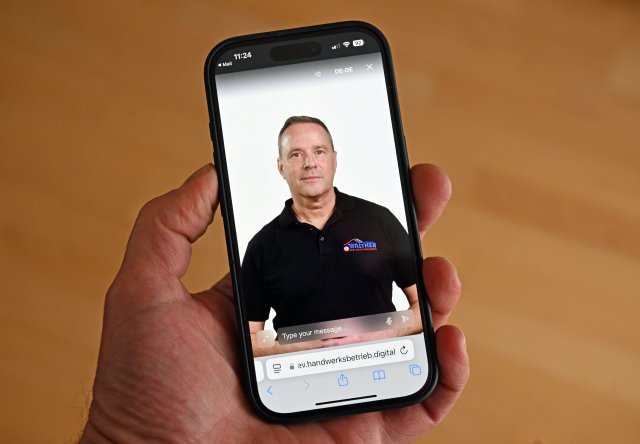Das Ende der fetten Jahre
Container-Reedereien, Häfen und Welthandelsexperten blicken sorgenvoll in die Zukunft - was kommt nach dem Globalisierungsboom?
»Hapag-Lloyd darf nicht untergehen«, mahnt Großaktionär Klaus-Michael Kühne. Die Hamburger Container-Reederei sorgte vor gut einer Woche für einen Paukenschlag: Man suche den Zusammenschluss mit dem Konkurrenten United Arab Shipping Company aus Kuwait. Das Unternehmen schwimmt im Geld und hat mehrere Containerfrachter bestellt, die Platz für fast 20 000 Boxen an Bord haben. Die Riesenklasse, die die Rennstrecke Asien-Europa befahren soll, fehlt bislang in der Flotte von Hapag-Lloyd. Die Konzernzentrale soll dennoch an der Elbe bleiben. Das will Kühne und das will auch die Stadt Hamburg, die ebenfalls an der Reederei beteiligt ist. Das deutsche Flaggschiff gilt trotz Fusion mit der chilenischen CSAV noch als zu klein und sucht weitere »Größenvorteile«.
Größenvorteile suchen allerdings auch Konkurrenten wie die dänische Maersk oder MSC aus Genf. Ein Grund sind die verschlechterten Rahmenbedingungen. Selbst nach der Finanzkrise bestellte die Branche weitere Schiffe. Über 400 stehen in den Auftragsbüchern der Werften weltweit: größere, um die Stückkosten pro gefahrener Seemeile zu senken, und Sprit sparende, um die hohe Kosten für den Treibstoff zu drosseln. Der tief gefallene Ölpreis macht jedoch einen Strich durch diese Rechnung. Und die neu bestellten Containergiganten vergrößern noch die bereits vorhandenen Überkapazitäten der Reedereibranche. Unter denen auch die Logistikkonzerne seit acht Jahren leiden: Manche Frachtrate deckt kaum die Kosten.
Noch bedrückender als die hausgemachten Probleme ist die Entwicklung der Weltwirtschaft. Einiges spricht dafür, dass Pessimisten wie der deutsche Industrieverband BDI oder das McKinsey Global Institute recht behalten, die ein Ende der fetten Jahre erwarten. 1985 bis 2014 ließen sich so mit europäischen wie mit US-amerikanischen Aktien durchschnittlich 7,9 Prozent im Jahr »verdienen«. Gewinne machen fiel vor allem Multis leicht: Die Inflation schien weltweit bezwungen, Demografie, neue Mittelschichten in Schwellenländern, Produktivitätsgewinne in der Industrie, der rasante Aufstieg Chinas sowie zunehmende staatliche und private Verschuldung sorgten für außerordentliches Wachstum der Weltwirtschaft und des Welthandels. Vorbei.
»Da der internationale Handel im Wesentlichen per Seeschiff abgewickelt wird, lassen die Containerumschläge zuverlässige Rückschlüsse auf den Welthandel zu«, heißt es beim Rheinisch-Westfälischen Institut für Wirtschaftsforschung. Das RWI erhebt monatlich den »Containerumschlag-Index«. Dazu werden die Angaben von 81 internationalen Häfen erhoben, die 60 Prozent des weltweiten Containerumschlags tätigen. Saisonbereinigt zeigt der Index bis 2014 nach oben - seither stagniert er. Dies bekommt gerade auch Deutschland zu spüren: Jedes vierte Containerschiff gehört deutschen Eigentümern. Die Flotte der Bundesrepublik ist mit Abstand die größte der Welt.
In der Eurozone, aber auch in Asien und Amerika schwindet der Glaube an die wohltuende Wirkung des freien Handels. Dass der transatlantische Freihandelsvertrag TTIP auch 2017 wohl nicht zum Abschluss kommen dürfte, ist da nur politisches Symptom. Das Scheitern der Doha-Welthandelsrunde ist ein weiteres. In der Krise setzen viele Staaten lieber wieder auf »Protektionismus« und den Schutz der heimischen Wirtschaft. So veröffentlichte die Regierung in Washington in dieser Woche eine Warnliste: Deutschland, China, Taiwan, Japan und Südkorea schadeten durch ihre riesigen Exportüberschüsse den US-Interessen.
Auch die Häfen konkurrieren noch schärfer miteinander. Einerseits werden in Asien, Afrika und Europa neue Hafenflächen eröffnet, anderseits sinkt das weltweite Ladungsaufkommen. Als »dramatisch« werden vor allem in Hamburg die Verluste des mit Abstand größten deutschen Seehafens in Richtung Russland empfunden. Zudem werfen die Fusion von Hapag-Lloyd und neue internationale Schifffahrtsallianzen die Frage auf, welche Häfen in Zukunft noch wie oft angelaufen werden.
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.