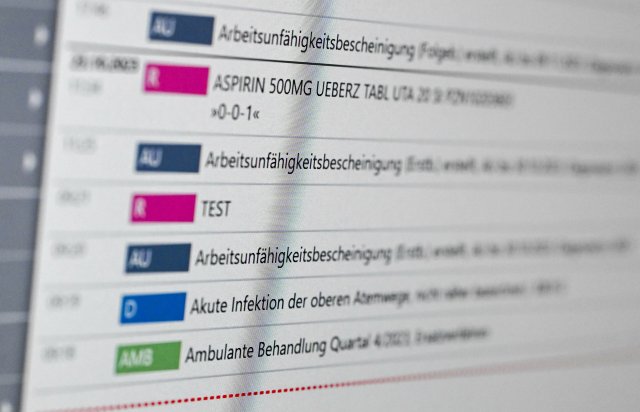An der russisch-österreichischen Grenze
Martin Leidenfrost suchte Habsburger Spuren in der Westukraine
Ein wenig enttäuscht es den Österreicher in mir dann doch, dass an der ehemals österreichisch-russischen Grenze niemand mehr von Österreich spricht. Da die habsburgische Westukraine zwischen den Weltkriegen polnisch war, erinnert man sich nur an »Polen«, und die Erinnerung im damals sowjetisch gewordenen Landstrich östlich davon ist von Stalins Verbrechen überlagert: 1300 Tote durch die künstliche Hungersnot »Golodomor«, verkünden Denkmäler, doppelt so viele durch Repressionen. Wo 1793 bis 1809 und 1815 bis 1918 Österreich an Russland grenzte, sprechen die Menschen immerhin noch von der »kleinen« und der »großen Ukraine«.
Drei Generationen nach der Vereinigung der beiden Sbrutsch-Ufer in einem Staat empfängt mich der Grenzfluss als Rinnsal. An beiden Ufern wohnen fast ausschließlich ethnische Ukrainer, äußerlich weist ein gelb-blau bestrichener Rastplatz des Gebiets Chmelnizkij auf eine innerukrainische Verwaltungsgrenze hin. Eine tiefe Provinz. Wolotschysk (zaristisch) und Pidwolotschysk (habsburgisch) sind mit Denkmälern vollgeräumt: für Stalin-Opfer, Afghanistan-Gefallene und Tschernobyl-Aufräumer am russischen Ufer; am österreichischen Ufer für die Unabhängigkeit, für die Nationalbewegung Ruch, für die Aufstandsarmee UPA, die Juden, Polen und Russen massakrierte, und noch eines - ganz in Gold - für die Mutterschaft an und für sich. In Pidwolotschysk ist die sowjetische Periode ausgelöscht, auf der Ehrengalerie in Wolotschysk werden Traktoristen als »Helden der sozialistischen Arbeit« geehrt.
Ich brauche einen Geldwechsler, man schickt mich in den Wolotschynsker Landgasthof »Kompromiss«. Im Halbdunkel ein langer Tresen mit 15 Ost-Cognacs. Ich frage nach Wasja. »Valutschik Wasja?«, erwidert die Barfrau. Sogleich steht aus einer feiernden Herrenrunde ein spätes Prachtexemplar jener Transformationsfiguren auf, die anderswo in Mittelosteuropa auch schon mal zu Oligarchen aufgestiegen sind. Wasja, um die 50, nennt sofort seinen Kurs. 29,20, super. Sein Goldzahn-Lächeln ist humangewitzt. Es führt mich vors »Kompromiss« und lüftet seine Lederjacke. Sie offenbart im linken Innenfutter eine Seitentasche, in der wie hineingeschneidert ein aufrechtes Vier-Zentimeter-Bündel von Hrywnja-Hundertern ruht. Wasja zählt 29 Hunderter runter, meinen Euro-Schein steckt er vertrauensvoll ein.
Nun ist Wasja neugierig auf mich. Ich zeige ihm das Buch »Getrennt und doch verbunden«, das Standardwerk des österreichischen Slawisten, Tischlers und Historikers Paulus Adelsgruber. Wasja ist Wolotschysker, aber mit Frau, Wohnsitz und Schweinefarm am Pidwolotschysker Ufer. Er breitet recht geläufige Meinungen aus: »In der Ukraine kämpfen Russland und Amerika gegeneinander«, »ich stünde im Donbass an der Front, wenn ich nicht jeden Monat hundert Karnickel auf den Lemberger Markt führen müsste«, »die UPA verteidigte die Ukraine, so wie das nun der Rechte Sektor tut, nur haben sie Juden wie Poroschenko im Rücken«. Das Fällen von Statuen, das während des Maidans auch den unscheinbaren Wolotschysker Lenin traf, findet er nicht richtig. »Wenn die in der Ostukraine meinen, soll man ihnen den Lenin stehen lassen, bis er von selber umfällt.« Er fragt: »Soll ich dir das Holocaust-Mahnmal zeigen?« Ich bejahe, ohnehin fehlen mir Spuren der Händler-Schtetl, die beide Grenzstädte vor hundert Jahren waren. Das mieseste Auto vor der Tür ist seines, ein röhrender Lada-Kombi mit geborstener Frontscheibe. »Einen Mercedes kann ich mir nicht erlauben, mein Business ist ja ungesetzlich.« Wasja tritt den Lada wie Hölle, jagt durch das dünne Siedlungsband, das sich zwischen den beiden ehemaligen Grenzbahnhöfen entwickelt hat, aufs Land. Irgendwo am Sbrutsch stoppt er. Enttäuscht erkenne ich ein weiteres Denkmal für die Hungersnot von 1933/34. »Ist doch dasselbe«, beharrt der fröhliche Valutschik, »Holocaust ist doch nur das russische Wort für Hungersnot.«
Die fortwirkenden Trennlinien ersehe ich am Brauch der Kreuz-Prozessionen - in Pidwolotschysk ein Aufmarsch von brutaler Macht, im größeren Wolotschysk ein lockerer Spaziergang weniger Unentwegter mit Vaterunser. Ansonsten scheinen die Ufer zusammenzuwachsen. Russisch will niemand mehr mit mir sprechen, und sowohl am russischen wie am österreichischen Ufer sind die faschistischen Farben Schwarz-Rot gehisst, Denkmäler sind massenhaft hinzugekommen. Diese erinnern an den laufenden Krieg.
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.