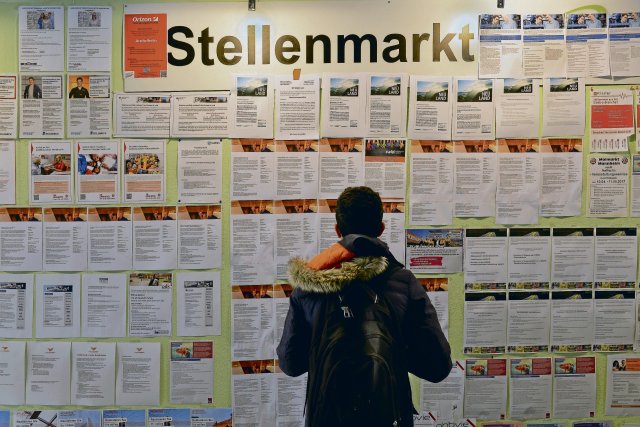Palästinenser müssen mit dem Wählen warten
Verfassungsgericht verschiebt kommunalen Urnengang wegen Unstimmigkeiten auf unbestimmte Zeit
Jahre lang hatten Sie gewartet, dann gebangt. Plötzlich ging alles ganz schnell. Ein paar Leute von der israelischen Zivilverwaltung in den palästinensischen Gebieten kamen vorbei, schauten sich das Haus an, dass die Familie Kawasmeh mangels Bearbeitung des bereits 2009 eingereichten Bauantrages vor zwei Jahren ohne Genehmigung gebaut hatte. In jenen, als Gebiet C bezeichneten Teilen des Westjordanlandes, die unter ziviler und militärischer Kontrolle Israels stehen, ist es für Palästinenser nahezu unmöglich eine Baugenehmigung zu erhalten.
Doch einige Tage nach dem Besuch der Beamten kam statt der erwarteten Abrissbagger der Postbote und ließ im gesamten Stadtteil rückwirkende Baugenehmigungen da. Fast zur gleichen Zeit stürmten außerhalb von Hebron israelische Soldaten das Gebäude eines palästinensischen Radiosenders, nahmen die Sendeeinrichtungen mit; über die Station, die der Hamas nahe steht, sei zur Gewalt gegen Israel aufgerufen worden.
Was auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun hat, hängt tatsächlich zusammen: Am 8. Oktober sollten in Palästina neue Kommunalparlamente gewählt; so war es jedenfalls geplant, bis am Donnerstag zunächst ein von der Hamas dominiertes Gericht in Gaza mehrere Wahllisten der Fatah von Präsident Mahmud Abbas verbot. Kurz darauf reagierte das Verfassungsgericht, das eher aufseiten der Fatah steht, mit einer einstweiligen Verfügung: Die Wahl müsse verschoben werden, weil ein ordnungsgemäßer Ablauf nicht gewährleistet sei, und überdies auch nicht überall gewählt werden könne. Israels Regierung hat die Wahl in großen Teilen Ost-Jerusalem verboten. Gleichzeitig hatte man aber auch mit einer Reihe von Erleichterungen versucht, die Palästinenser davon zu überzeugen, dass »Mäßigung Vorteile bringt«, so Verteidigungsminister Avigdor Liebermann im Rundfunk.
So wurden unter anderem auch Straßensperren abgebaut, hat Regierungschef Benjamin Netanjahu ein Treffen mit Präsident Mahmud Abbas, diesmal unter Schirmherrschaft des russischen Präsidenten Wladimir Putin, in Aussicht gestellt.
Denn der Wahl wurde einige Bedeutung beigemessen. Die örtlichen Verwaltungen haben in Palästina weitreichende Befugnisse; sie können also Entscheidungen der Regierung blockieren. Zudem gilt sie, mangels der seit Jahren überfälligen Präsidentschafts- und Parlamentswahl, auch als Stimmungsbarometer zur politischen Großwetterlage. Schon jetzt ist in Fatah und PLO ein Machtkampf um die Nachfolge des mittlerweile über 80-jährigen Abbas in vollem Gange; gleichzeitig sorgt man sich um den Übergang. Abbas selbst war nach dem Tode von Jassir Arafat zunächst hinter verschlossenen Türen gekürt und erst später durch eine Wahl bestätigt worden, wie es in der Verfassung vorgesehen ist.
Sowohl die israelische als auch die palästinensische Regierung befürchteten eine Serie von scheppernden Niederlagen für die Fatah, die wiederum dazu geführt hätten, dass Abbas einen Großteil der Unterstützung innerhalb der politischen Gremien verloren hätte, die ihn momentan noch im Amt hält. Dass das Verfassungsgericht nun nicht nur die Wahl verschoben, sondern Wahlen gänzlich in Frage gestellt hat, so lange sie in Ost-Jerusalem nicht möglich sind, hat sowohl bei der israelischen Regierung, als auch im Hause Abbas für Erleichterung gesorgt. Sollte das Gericht in der Hauptverhandlung am 21. September daran festhalten, könnten PLO und Fatah die Wahlen einfach unter Verweis auf das Urteil weiterhin hinausschieben.
Die Ereignisse vom Donnerstag machen aber auch deutlich, wie groß die Unterschiede zwischen Gaza-Streifen und Westjordanland mittlerweile sind, und wie wenig Einfluss die Einheitsregierung aus Fatah und Hamas, die im Juni 2014 gebildet wurde, tatsächlich in Gaza hat: Die Macht dort hat eine Schattenregierung, die der einstigen Hamas-Regierung entspricht. Sie kann auf eigene Polizei und Behörden zurückgreifen.
Für die Familie Kawasmeh hat all dies indes eher wenig Bedeutung: »Die Wahl hat uns mehr gebracht, als wir erwartet haben«, sagt Ali, der Familienvater.
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.