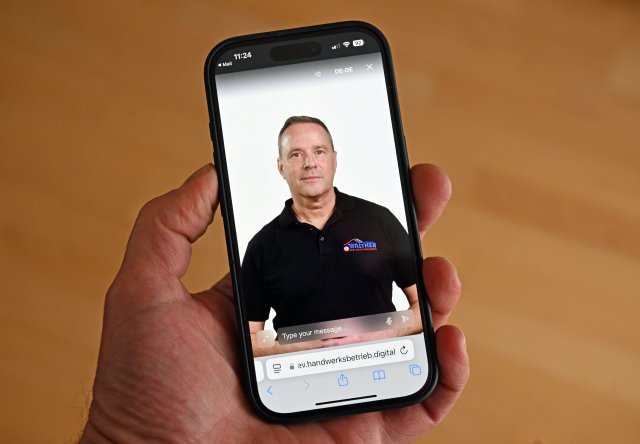Agrarland ist keine normale Handelsware
EU-Abgeordnete warnen vor wachsender Bodenknappheit in Europa und wollen Ausverkauf stoppen
Landknappheit, Konzentration von Agrarflächen und massiver Aufkauf von Boden durch multinationale Konzerne - das sind Probleme, die man auf Entwicklungsländer in Afrika, Asien oder Mittel- und Südamerika beschränkt glaubte. Auch die EU sah sich bei der Beschäftigung mit diesen Problemen bislang in der Rolle des Außenstehenden. Doch längst ist Landknappheit auch in Europa selbst zu einem Problem geworden.
Darauf weisen jetzt Abgeordnete des Europaparlaments hin. »Aktueller Stand der Konzentration von Agrarland in der EU: Wie kann Landwirten der Zugang zu Land erleichtert werden?«, heißt der Entwurf für einen sogenannten Initiativbericht, der zurzeit im Agrarausschuss in Arbeit ist. Ausgangspunkt ist folgender Befund: 2010 war die Hälfte der landwirtschaftlich genutzten Flächen in der EU in den Händen von drei Prozent der landwirtschaftlichen Betriebe. Zahlen aus 2012 besagen, dass 80 Prozent der Betriebe nur zwölf Prozent des Agrarlandes besitzen. Kurzum: Wenige Betriebe besitzen überproportional viel Land, und die Konzentration schreitet weiter voran.
»Ab etwa 2007 ist es zur Mode geworden, Geld in Agrarland zu investieren«, sagt Maria Noichl (SPD), Berichterstatterin im Agrarausschuss. Auch Konzerne, die gar nichts mit Landwirtschaft zu tun hätten, sähen Land als Geldanlage. Das löse eine Kette von Problemen aus: Die Preise für Land schnellen nach oben, junge Landwirte können kein Land mehr kaufen, Höfe, Dörfer und ganze Regionen würden von ihren Bewohnern verlassen. Das wiederum habe weitreichende Auswirkungen auf die gesamte Gesellschaft, bis hin zur Wasserversorgung, der Biodiversität und der Sicherung der Nahrungsmittelproduktion. »Eine breite Eigentumsstreuung ist ein wesentliches Grundprinzip der sozialen Marktwirtschaft und eine wichtige Voraussetzung für den gesellschaftlichen Zusammenhalt einer Volkswirtschaft«, schreibt Noichl in ihrem Berichtsentwurf. Agrarland sei keine normale Handelsware, denn Boden sei nicht vermehrbar und der Zugang dazu ein Menschenrecht. Oder wie es die grüne Schattenberichterstatterin Maria Heubuch ausdrückt: »Land ist kein Auto.«
Der Agrarausschuss hatte sich dem Thema angenommen, nachdem schon der Wirtschafts- und Sozialausschuss, ein beratendes Gremium der gesetzgebenden EU-Einrichtungen, Anfang 2015 auf das Problem der Landkonzentration in der EU hingewiesen hatte. Ausführungen von niederländischen Experten bestärkten den Agrarausschuss dann, das Thema mit einem Initiativbericht anzugehen. Und Anfang Dezember widmeten die europäischen Grünen dem Mangel an verfügbarem Land in der EU eine ganztätige internationale Konferenz in Brüssel.
Sollte der Ausschussbericht, wie anzunehmen, Anfang 2017 vom Plenum mit breiter Mehrheit angenommen werden, wird er zu einer Aufforderung an die EU-Mitgliedsländer und die EU-Kommission, sich mit dem Thema zu befassen. Im besten Fall könnten Vorschläge zu Gesetzesänderungen am Ende herauskommen.
Noichl, Heubuch und ihre Kollegen hätten dafür bereits klare Vorstellungen. So sollten in einem ersten Schritt europaweit vergleichbare Daten über die Landkonzentration gesammelt werden. Belastbares Zahlenmaterial sei bislang nämlich viel zu wenig vorhanden. Außerdem müsse die EU-Kommission klarstellen, welche Mittel erlaubt seien, sich gegen den Ausverkauf von Land zu schützen. »Gerade in Osteuropa versuchen Staaten, sich dagegen zu wehren«, berichtete Noichl. Aber häufig würden diese Staaten von der EU-Kommission zurückgepfiffen, weil sie mit den Schutzmaßnahmen gegen Regeln des Binnenmarktes verstoßen. Ein unhaltbarer Zustand, finden die Europaabgeordneten. Staaten müssten hier in ihren Rechten gestärkt werden.
Ein von der EU-Ebene ausgehender Kampf gegen den zügellosen Ausverkauf von Land werde außerdem hilfreich sein, Korruption in Europa einzudämmen. »Nach dem Zoll gilt Boden als zweitgrößter Bereich für Korruption«, sagt Noichl.
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.