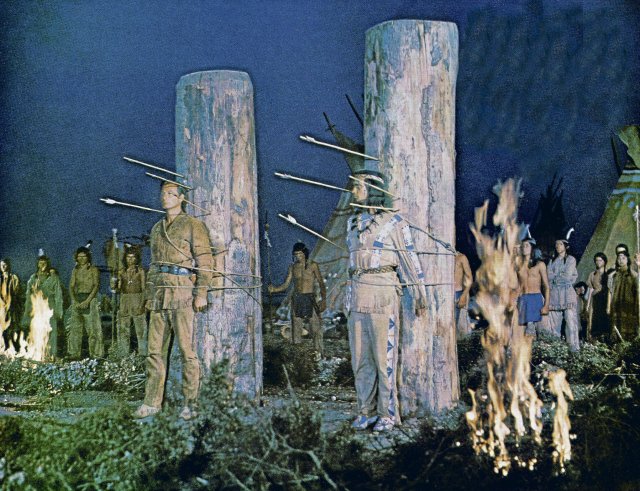- Kultur
- Alfred Kerr
»Gott hat mich eingesetzt«
Deborah Vietor-Engländer: »Alfred Kerr. Die Biographie« - Deutschland und das Feuilleton
Sein Gift ist nach wie vor Geist, der Leben gibt. Seine Säure ist erfrischender Quell. Seine Galle spendet Herzblut. Man betrachte sich, im Kontrast zu Alfred Kerr, landläufige Sarkasmusbeamte: ach, wie sie ihre Wörter zu schwitzenden Gebilden zusammentreiben, die als Pointen durchgehen sollen.
Kerr keilt, kerbt, keult, er kennt nur zwei Wege: »jauchzen oder rülpsen«. Aber im Grunde war er gar kein Theaterkritiker, denn Kritiker sind zu unbegabt, um ihre Zeit zu überleben. Kerr dagegen lebt. Als Feuilletonist ist er ein Erzähler, als Rezensent ein Dramatiker. Bei ihm gehen Theatervorhänge hoch - für das Schauspiel, das sich in seinem Kopf abspielt. Er dient Dichtern nicht - deren Werke sind ihm Zuträger für eigene Phantasien. Weil er selber Dichter ist. Weil er über mehr Sinne verfügt, als man sich Sinn anlesen kann. Er ist bestechend arrogant und aufreizend spielerisch. Arrogant, weil er auf Niveau besteht - statt nur immer darauf, Leser an die Hand zu nehmen. Und spielerisch, indem er selbst noch Kalauer ganz lässig in die Kunst kegelt.
Deborah Vietor-Engländer hat nun die erste Biographie dieses feuilletonistischen Genies geschrieben; eine gelungene Balance zwischen Leidenschaft und Wissenschaft. In Breslau war Kerr 1867 als Sohn des jüdischen Weinhändlers Emanuel Kempner geboren worden. Und ehe ihn das Schicksal unsäglich unter der deutschen Diktatur leiden lässt, zwinkert es ihm zu: Denn Alfred K. wird genau zu Weihnachten geboren - als sei dies der kalendarische Vorschuss für ein Leben als neuer Heiland der Theaterkritik. »Gott hat mich eingesetzt, jedes Beiseitesprechen zu verhindern.« Diese Ironie höherer Weihe behält er bis ins bittere Exil, nennt sich am Ende »ein bisschen Papst mit Pensionsberechtigung«.
Die Autorin beschreibt anschaulich, was ihn treibt:»Lust und Trauer an der romantischen Herrlichkeit«. Und eines Tages ist aus Alfred Kempner, der als Schüler nur mäßige Deutsch-Zensuren schaffte - Kerr geworden. Eine scharfe Abgrenzung zur peinlichen Verwandten, der ungelenk kitschigen Dichterin Friederike Kempner. Kerr ist ein ethischer Kämpfer, ein Unbestechlicher. Er verweigert die Taufe - um den späteren Preis einer Universitätslaufbahn. Er kämpft jahrelang für ein Heinrich-Heine-Denkmal: jüdische Solidarität und - erhabener deutscher Geist. Der diesem Land mehr und mehr verloren geht.
Ausführlich lässt Vietor-Engländer den Schriftsteller zu Wort kommen, zitiert lange Passagen aus Texten, die er für renommierte deutsche Blätter schreibt - so können sich Zauber und Zunder dieses Werkes einprägsam mitteilen. Die Recherche der Autorin überzeugt, ihre Erzählweise hat Schwung, Herz und sprachliche Kraft. Welche eine Zeit damals! Feuilletons gleichen Frontlinien. Jeder Satz eine Salve, jeder Text ein Sturmangriff. Das Duell ist noch nicht zum Diskurs verläppert. Karl Kraus pfeffert gnadenlos aus Wien, Kerr torpediert zurück.
Eine Zeitung, damit sie erscheinen kann, besteht aus vielen Redakteuren, aber wie in jeder Sparte sind die Begabungen in der Minderzahl. Kerr schafft sich eines Tages, gleichsam als Notwehr, sein eigenes Blatt: »Pan«. Es besteht irgendwann aus fast nur einem einzigen Autor: Kerr. So darf es sein, wenn man einen Beruf lebt, statt ihn nur auszuüben. Im Feuilleton, das beweist Kerr, wird jede Zeitung noch einmal erfunden. Feuilleton ist Spracherholung durch Sprachpflege. Ist Gespräch der Gebildeten, ist Verständigungskreis der Kenner und Liebhaber. Kerr: »Aus einem Gedanken macht der Stückemacher ein Stück. Der Schriftsteller einen Aufsatz. Ich einen Satz.« Er achtet in seinen Texten auf präzisen Bau, auf bebensichere Statik, auf klare Setzungen. Daher auch die römischen Ziffern zwischen den Abschnitten: Die Form meißelt - zum Fazit geht’s gleichsam wie über weiße Stufen.
Seine literarischen Hausgötter sind Horváth und Ibsen, Schnitzler und Hauptmann. Als der ihm zu nazinah wird, lässt ihn der konsequente Antifaschist Kerr fallen: »Sein Andenken soll verscharrt sein unter Disteln; sein Bild begraben im Staub.« Nicht nur Thomas Mann verspottet er (der habe eine »Siegfried-Hornhaut« am Hintern), auch Bertolt Brecht. Für ihn ein Fühlloser, in seinem Zeige-Theater so gänzlich ohne Nerv fürs »Menschen-Drama«; einer, der seine poetische Bosheit dem Ideologieseminar opfert - in der »Mutter« sieht Kerr ein kommunistisches »Idiotenstück«. Dem politisch motivierten Theater spricht er durchaus Mut zu - wenn es denn ein Kunst-Werk bleibt und sich nicht, und sei es für die beste Sache der Welt (ach, welche wäre dies denn?!), agitierend prostituiert.
Füllig ersteht in diesem Buch das frühe 20. Jahrhundert. Jenes politische Flackern der Weimarer Republik, in dem schon die Flammen der kommenden Finsternis züngeln. Jenes pulsierende gesellschaftliche Leben, darin eingekeimt bereits: die künftige Lähmung. Und mittendrin Kerr, der jeden Zuschauerraum betritt, als sei es die Bühne. Es ist die Bühne. Seine Bühne. Der Galan in Dienstkleidung, dem »reinen Oberhemd«, schafft es, dass sein Erscheinen im Saal als Auftritt, seine Anwesenheit bei einer Premiere als szenisches Ereignis gilt. Und auch in seinen privaten Facetten wird er gezeichnet. Viel Genuss, viel Weiberei, viel Beziehungstragik. Als er mit fünfzig noch einmal heiratet, hetzt der Schwiegervater Schläger auf Kerr. Der betreibt lässige Konfliktlösung: Er geht mit den Gedungenen in die Kneipe.
Kerr hatte gegen die Zensurpraxis des kaiserlichen Hohenzollern geschrieben, er redete in Rundfunksendungen gegen das Wetterleuchten der Nazis, diese »deutsch-national-völkische Rückwärtserei«. 1929 attackiert Goebbels den Schriftsteller auf gröblichste Weise, so dass sich beizeiten abzeichnet, was ihm bald widerfahren würde: Urplötzlich verliert er alles - Staatsbürgerschaft, akademischen Titel (er hatte über Clemens Brentano promoviert), das Lebensmittel Sprache. Kerr wird die Krone vom Haupt geschlagen. Ein Hieb, als sei es der Kopf selbst.
Das Exil beginnt vierzehn Tage nach Hitlers Herrschaftsbeginn, mit einer kleinen Reisetasche. Prag, Paris, London - wo Kerr, seine Frau und die beiden Kinder zunächst als gestempelt gelten: Ausländer aus Feindesland. Eine Wohnung wird Traum bleiben, Geld auch. Kerr schreibt weiter, unablässig, aber sein glanzvoller Name ist nun hauptsächlich eine stumpf gewordene Kennung im bittstellenden Dauerschriftverkehr mit Ämtern, Genehmigungsstellen, Hilfsorganisationen.
Im Oktober 1948 wählt Kerr, britischer Staatsbürger, den Freitod. Gedichtet hatte er: »Man stirbt einen Tod; man weiß nur nicht welchen;/ Vielleicht ein schmuckes Schlaganfällchen.« Ihn trifft’s - standesgemäß und pointensicher - während eines Theaterbesuchs in Hamburg. Auf die schwere Lähmung antwortet er mit einer Überdosis Veronal.
Bücher, die erzählen, was war, sind Verweise auf das, was ist. Deborah Vietor-Engländers Buch ergreift - mit jenem Elendsbild, das sie, Kerr begleitend, von jenem finsteren Deutschland entwirft. Gut, wenn einem auf diese Weise bewusst wird, in welcher Glücksgegend wir - trotz aller Nöte - heute leben. Ich denke daran, wie Publizist Bernd Ulrich in der Hamburger »Zeit« jüngst unser Gegenwartsdeutschland beschreibt: »Sparsam im Umgang mit den nationalen Symbolen, mit einer im internationalen Maßstab wenig brillanten, dafür aber ungewöhnlich unkorrupten politischen Klasse, gesegnet mit einer Medienlandschaft, die andere sich wünschen würden«, und die Verhältnisse sind so organisiert, »dass niemand mehr durchgreifen oder durchregieren kann«. Du tauchst in Kerrs Leben, bist von Größe ergriffen, dann von Traurigkeit - und fühlst, wie verschont du selber leben darfst.
Im Übrigen blieb der Theatergänger Alfred Kerr stets ein Weltreisender, er schrieb grandiose »Plauderbriefe« von unterwegs; Günther Rühle, ebenfalls ein Schauspiel(er)beschreiber von Rang, hat viele von ihnen, verfasst für die »Breslauer Zeitung«, vor Jahren wiederentdeckt. Es wurden Bestseller.
Warum? Weil wir in Kerr dem so flüchtigen wie treffsicheren Herumblicker begegnen, der sich den Ordnungen, den straffen Zeitplänen und der sozialen Pression des gewöhnlichen Arbeitstages geistreich entzieht. Flaneure sind Spezialisten des kleinen Zwischenfalls, der nichts verändert, aber alles in Frage stellt. Wenn sie die Straße betreten, geht ihr Blick schon fremd. Sie können nur ehrlich sein, indem sie treulos sind zu allem, was Festpunkt und Standpunkt sein will. Kerr als guter Lehrer: Man muss das Dasein nur im richtigen Winkel von der Seite anschauen, und schon ist dies das Ende der realen Bedrohungen.
Deborah Vietor-Engländer: Alfred Kerr. Rowohlt, 718 S., geb., 29,95 €.

Das »nd« bleibt gefährdet
Mit deiner Hilfe hat sich das »nd« zukunftsfähig aufgestellt. Dafür sagen wir danke. Und trotzdem haben wir schlechte Nachrichten. In Zeiten wie diesen bleibt eine linke Zeitung wie unsere gefährdet. Auch wenn die wirtschaftliche Entwicklung nach oben zeigt, besteht eine niedrige, sechsstellige Lücke zum Jahresende. Dein Beitrag ermöglicht uns zu recherchieren, zu schreiben und zu publizieren. Zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit deiner Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Sei Teil der solidarischen Finanzierung und unterstütze das »nd« mit einem Beitrag deiner Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.