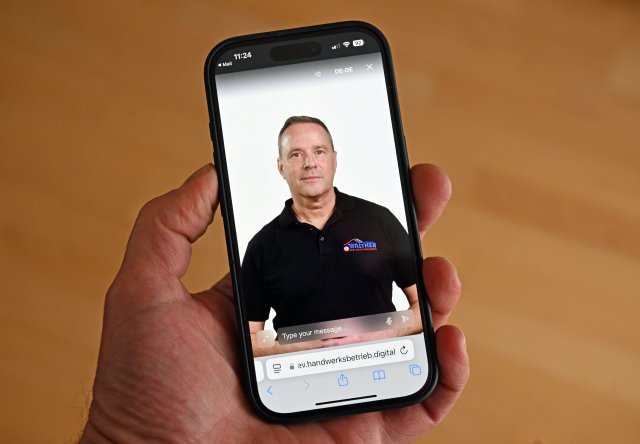- Wirtschaft und Umwelt
- Wohnungsmangel und Neubau
Die Platte kommt zurück
Verbände wollen Wohnungsmangel mit seriellem Bauen bekämpfen
Mit einer am Dienstag in Berlin unterzeichneten Rahmenvereinbarung zwischen den Spitzenverbänden der Bau- und Wohnungswirtschaft und dem Bundesbauministerium soll der Einsatz serieller und modularer Bauweisen für den Wohnungsbau flächendeckend etabliert werden. Dabei bedeutet serielles Bauen, dass Häuser am Ort nicht Stein für Stein errichtet werden, sondern dass - ähnlich wie bei der Plattenbauweise - fertige Komponenten verwendet werden.
Grundlage der Vereinbarung ist eine europaweite Ausschreibung für Musterbauten auf Grundlage vorgefertigter Bauteile, deren Ergebnisse ebenfalls am Dienstag präsentiert wurden. Neun der rund 50 von Unternehmen und Bietergemeinschaften eingesandten Entwürfe erhielten den Zuschlag. Nach der Erteilung der Typenbaugenehmigungen können Wohnungsunternehmen in ganz Deutschland die in dem Katalog enthaltenen Bautypen zu Festpreisen bestellen und ohne weitere Ausschreibung realisieren.
Gunther Adler, Staatssekretär beim Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat, bezeichnete die Vereinbarung als »Meilenstein für den Wohnungsbau«. Angesichts der dramatischen Lücke zwischen Neubaubedarf und den derzeitigen Fertigungszahlen seien serieller und modularer Neubau wichtige Bausteine für das angestrebte Ziel, in dieser Legislaturperiode insgesamt 1,5 Millionen neue Wohnungen zu errichten.
Auch Axel Gedaschko, Präsident des Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobillienunternehmen (GdW) lobte die Vereinbarung. Dabei gehe es nicht um eine »Rückkehr zum Plattenbau der 70er Jahre«, sondern gleichermaßen um »Quantität, Qualität, Nachhaltigkeit und vor allem die gesellschaftliche Aufgabe, bezahlbaren Wohnraum für alle Schichten der Bevölkerung zu schaffen«.
Marcus Becker, Vizepräsident des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie, sprach von einem »großen Wurf«: Die stetig wachsende Bautätigkeit habe bereits zu erheblichen Engpässen und Preissteigerungen in der Branche geführt. Jetzt gelte es, die Potenziale, die in der seriellen Bauweise steckten, auszuloten und konsequent zu nutzen. Bauprojekte könnten auf diese Weise schneller und kostengünstiger realisiert werden, ohne Abstriche bei der Qualität.
Die prämierten Entwürfe, die jeweils noch verschiedene Variationsmöglichkeiten aufweisen, decken einen Großteil denkbarer Wohnungsbauvorhaben ab; von der innerstädtischen Verdichtung durch Lückenschließung bis zu größeren Komplexen in Neubaugebieten, von reiner Wohnbebauung bis zu Gemischtnutzungen mit Gewerbeanteilen. Die tatsächliche Kostenersparnis gegenüber konventionellen Bauprojekten lässt sich laut Michael Neitzel, der als Geschäftsführer des Instituts für Wohnungswesen, Immobilienwirtschaft, Stadt- und Regionalentwicklung maßgeblich an der Ausschreibung beteiligt war, nicht eindeutig beziffern. Doch besonders bei größeren Abnahmemengen könne sie »erheblich« sein. Zudem würden die Baukapazitäten durch kürzere Fertigstellungszeiten deutlich ausgeweitet werden können.
Quantitative Angaben zum möglichen Einsatz serieller Bauweisen in den kommenden Jahren mochte allerdings keiner der Akteure abgeben. Einig waren sich alle Experten bei der Einschätzung, dass die Senkung der Baukosten nur eines von vielen Puzz- leteilen bei der möglichst schnellen Schaffung von ausreichend bezahlbarem Wohnraum sei. Denn die besonders in Ballungsräumen explodierenden Grundstückspreise seien ebenfalls ein erheblicher Kostenfaktor. Staatssekretär Adler räumte ein, dass dabei auch der Bund in der Pflicht stehe. Bundeseigene Grundstücke müssten in »viel stärkerem Maße als bisher« nach konzeptionellen und städtebaulichen Kriterien vergeben werden, statt nach dem Höchstpreisprinzip. Auch Länder und Kommunen hätten noch beträchtliche Möglichkeiten bei der Erschließung und Vergabe von Baugrundstücken und der Beschleunigung der Planungs- und Genehmigungsverfahren.
Als Allheilmittel für die soziale Wohnraumversorgung taugt serielles Bauen ohnehin nicht, jedenfalls nicht ohne weitere Förderung beziehungsweise Gemeinwohlorientierung. Laut GdW-Präsident Gedaschko beträgt die Kostenmiete dieser Neubauwohnungen auch unter günstigen Voraussetzungen immer noch acht bis neun Euro pro Quadratmeter, also deutlich mehr, als Millionen Haushalte zahlen können.
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.