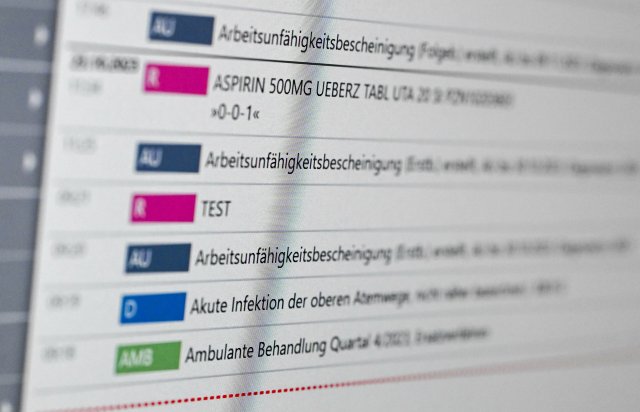- Kommentare
- EinGEPENDELT
Das Problem der letzten Meile
Die Welt sieht jeden Tag anders aus. Eine zugegeben nicht bahnbrechende Erkenntnis, die aber ihre ganze Tiefenwirkung sehr gut dann entfaltet, sieht man jeden Tag denselben Streifen Welt am mehr oder weniger verschmutzten Fenster des Waggons vorbeiziehen. Da verfallen zusehends Ruinen alter Lagerhallen (steinern, arbeiteten hauptsächlich Menschen drin), werden aus Äckern erst Gruben, dann Stahlgerüste, schließlich neue Lagerhallen (metallen, arbeiten hauptsächlich Roboter drin). Auf manch Werden und Vergehen kann man genauer schauen, wenn es entlang der sogenannten Langsamfahrstellen geschieht: Streckenabschnitten, die nicht etwa ob der Kontemplation durchschlichen werden, sondern schlicht, weil etwa das Gleis oder der Oberbau kein höheres Tempo zulassen.
Das Pendeln ist Zeitläufen unterworfen, täglichen wie auch deutlich längeren. Und so lassen sich dabei auch Probleme finden, die man aus anderen Feldern des täglichen Lebens im Spätkapitalismus kennt. Probleme, die anders als Langsamfahrstellen tatsächlich an die Substanz gehen. Denn auch wenn eine Langsamfahrstelle meist auf einem Substanzproblem (zum Beispiel der Bausubstanz) beruht, geht es nach einer Weile eben meistens wieder schneller. Liegt sie aber am Ende des Weges, quasi in Sichtweite des Ziels, geht sie an die Nerven. Dann wird es zu einem »Problem der letzten Meile«, wie man es aus der Logistik oder der Datenfernübertragung kennt: Sie können das DHL-Auto samt Paketboten schon sehen, aber Letzterer klingelt dann doch nicht, und Sie müssen, wenn es wenigstens eine Benachrichtigung gibt, weite Wege zurücklegen, um an ein Paket zu gelangen, das schon wenige Meter vor Ihrer Haustür war. Oder Sie schicken eine riesige Datei per E-Mail. Die kommt auch mit großer Geschwindigkeit an - zumindest bis zum letzten Verteilerknoten vor Ihrem Haus. Wenn das allerdings in einer ländlichen Gegend liegt, so fehlen dann noch ein paar Meter oder auch mehr … und dann wird es kompliziert.
Das Problem der letzten Meile gibt es auch beim Pendeln. Während 98 Prozent der Strecke fast ausnahmslos ohne Probleme vorbeirauschen (und man Langsamfahrstellen mit Langmut begegnet), sind die letzten zwei Prozent der Strecke des Autors tägliche Tortur: Wäre er wie im obigen Logistikbeispiel ein Paket, hätte der Paketbote täglich schlechteste Laune, würde Klingelschilder absichtlich nicht lesen und unleserlich machen, hätte Spaß daran, das Paket dort hineinzupressen, wo eigentlich nichts mehr reinpasst. Wäre der Autor wiederum ein Datenpaket, würde gefühlt jeden zweiten Tag der Verteilerkasten vor dem Haus brennen und das ISDN-Modem quäkende Geräusche von sich geben. Auf dem Bildschirm des Empfängers würde eine Windows-XP-Fehlermeldung erscheinen: »Wegen Verzögerungen im Betriebslauf …«
Die letzte Meile vieler Pendler muss mit der S-Bahn in Berlin absolviert werden. Diese bietet jeden Tag das volle Programm aus der Pendlerhölle: Zu viele Menschen auf zu wenig Platz in zu selten oder gar nicht fahrenden Zügen, über die in einer Art und Weise kommuniziert wird, die sich nur eine sehr misanthropische KI ausgedacht haben kann. An einem sehr schlechten Tag. Mit Regen. An dem vermutlich trotzdem ein Verteilerkasten brannte.
Nun sind Pendler zum Glück (noch) keine Pakete oder Datenpakete, und so haben sie gegenüber Letzteren auch einen Riesenvorteil: Auf dem Rückweg ist die »letzte Meile« nämlich die erste - und wenn man die erst einmal hinter sich hat, kann einen auch die längste Langsamfahrstelle nicht mehr schrecken und man kann sich wieder den Weltenläufen vor dem Zugfenster widmen. Apropos, stand da nicht neulich noch ein Verteilerkasten vor dem metallenen Logistikzentrum?
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.