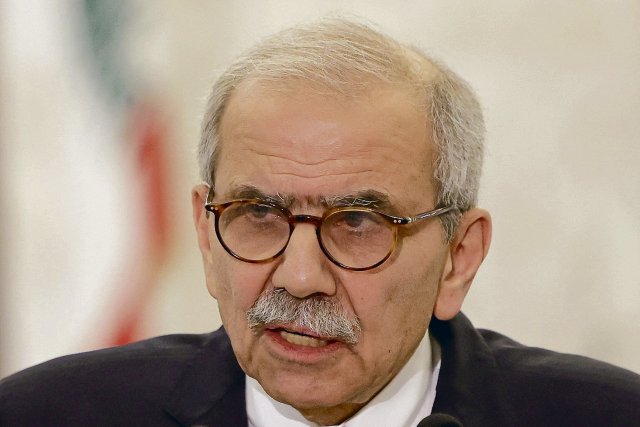- Politik
- SPD
Sozialdemokratie, wie wir sie kannten
Als sozialpolitischer Lieferdienst unterfordert die SPD sich selbst und alle, die etwas von ihr erwarten könnten.
Sozialdemokratie ist Partei, Tradition, Bewegung und Idee. Und sie ist Hoffnung, Enttäuschung und Mitleid. Man kann das gerade jetzt ganz gut sehen: Es gibt viele Leute, die sich aus guten Gründen eine starke SPD erhoffen, vor allem aber, wobei das eine das andere voraussetzt: eine SPD mit sozialdemokratischer Politik. Diese Hoffnung wird den Menschen nicht eben einfach gemacht, da die Partei immer auch eine große Quelle der Ernüchterung war und ist.
Warum sollten Wähler*innen auf jemanden setzen, der dann die aus ihrer Sicht falschen Dinge tut? Die gerade führenden Genoss*innen sehen das zwar anders, was sie durch Verweise auf dieses oder jenes Gesetz glaubhaft machen wollen, darauf, dass sie »geliefert haben«. Aber Hoffnung wird dadurch offenkundig nicht entfacht. Im Gegenteil: Weil der politisch-mediale Betrieb keine Denkpausen oder Auszeiten zulässt, müssen Sozialdemokraten trotzdem immerzu weiter über sich reden. Das löst dann bisweilen Mitleid aus, etwas, das im Periodensystem der politischen Elemente gleich neben Häme steht.
»Die Chance, stärkste Partei zu werden, ist bei der nächsten Bundestagswahl deutlich größer als in vielen Jahren zuvor«, hat Olaf Scholz dieser Tage einem Magazin gesagt. Und natürlich haben alle gelacht. Die Umfragezahlen der SPD oszillieren um die 15 Prozent, da liegt das Kanzleramt ziemlich, also sagen wir: sehr weit weg. Nun kann man natürlich über den Bundesfinanzminister spotten oder ihm Realitätsverlust unterstellen. Diese Möglichkeit ist von politischen Mitbewerber*innen auch vielfach genutzt worden: Haha.
Politik ist kein Lieferservice
Man sollte Olaf Scholz ernst nehmen. Er verweist auf die Tatsache, dass bei der nächsten Wahl erstmals seit Jahrzehnten keine der Parteien mit einer Kanzlerin oder einem Kanzler antreten wird. Soll heißen: Der politische Wettbewerb wird nicht durch irgendeinen am Amt hängenden Bonus verzerrt. »Wenn wir es gut machen, haben wir also eine Chance«, sagt Scholz weiter - und das ist nicht bloß von den Spielregeln des politisch-medialen Betriebs aufgezwungenes Gerede, wo man ja immer optimistisch sein muss.
Es steckt mehr drin, nämlich der Hinweis auf eine tiefer liegende Ursache der sozialdemokratischen Krise: Die Lage der SPD, Scholz hat dies mit Blick auf die »Halbzeitbilanz« Ende des Jahres gesagt, sei »eine Mahnung, uns nicht am langen Arm verhungern zu lassen«. Dies bezeugt, wie sehr in der SPD Politik als eine Art Lieferservice fehlverstanden wird. Bürger*innen werden vor allem als Konsument*innen von »Erfolgen« betrachtet, die man anderen Parteien in Koalitionen abgerungen hat. Führende Sozialdemokraten zählen gern auf, was die SPD da alles »für sich verbuchen« könne. Eigentlich. Denn der Wettbewerb ist ungerecht, oder wie es Andrea Nahles einmal mit Blick auf von ihrer Partei durchgebrachte Gesetze formuliert hat: »Es spricht nur keine Sau darüber.«
Wäre die Krise der Sozialdemokratie nur ein Kommunikationsproblem, eine Werbekampagne könnte helfen. Das Problem ist aber etwas größer. Politik ist für die SPD-Führung nicht mehr »die soziale Mobilisierung in der Gesellschaft«, so der Soziologe Oliver Nachtwey, »sondern der rein gouvernementale Kampf um politische Coups«.
Falsch abgebogen
Das war nicht immer so. Wann ist die SPD falsch abgebogen und warum? Wenn heute in der SPD von »Erneuerung« die Rede ist, meint das in aller Regel Änderungen in der Organisationskultur (mehr Internet, mehr Mitsprache) oder die Korrektur von »politischen Coups«, die nicht gut bei den Menschen angekommen sind (Hartz-Reform). Das Verständnis von dem, was zu einer politischen Renaissance nötig wäre, bleibt auf das Selbstverständnis als Lieferdienst beschränkt. Das klingt dann manchmal wie »Ganz neu: Sozialpolitik-Wochen bei der SPD!«
Wenn außerhalb der SPD das Schlagwort von der »Erneuerung« gerufen wird, geht es meist um Projektionen: Wie wünsche ich mir die Sozialdemokratie? Die Frage wird bei der Kapital-Lobby anders beantwortet als bei der Linkspartei. In einem aber sind sich die Antworten ähnlich: Es geht meist darum, ob die SPD von der rot-grünen Agenda von 2003 abkehren solle oder eben nicht. (Für manche Linke ist das viel zu kurz gedacht, sie würden gern T-Shirts tragen mit der Aufschrift »SPD: an allem schuld seit 1914«.)
Schlagen wir eine andere Zahl vor: 1973. Um dieses Jahr herum hat der Parteienforscher Franz Walter den sozialdemokratischen Krisenbeginn taxiert: Damals »begann die Welt der alten Sozialdemokratie unterzugehen«.
Erstens hatte das etwas mit gravierend veränderten Bedingungen zu tun: ein erlahmendes Wachstum und damit schrumpfende Möglichkeiten, aus dem Mehrprodukt bei steigender Produktivität soziale Integration durch Umverteilung zu speisen; eine neue, strukturelle Massenerwerbslosigkeit, gegenüber der die bisher betriebene keynesianische Steuerung versagte; das Ende des Fordismus mit seiner klassischen Massenarbeit; das Aus für das globale Währungssystems von Bretton Woods; der Aufstieg dessen, was man heute gern Neoliberalismus nennt und so weiter.
Dadurch geriet die vorübergehend ganz erfolgreiche »Harmonisierung der Rentabilitätsinteressen des Besitzbürgertums mit den Verteilungsansprüchen der Arbeitnehmer dank üppiger Wachstumserfolge der Industrie« in die Krise. Damit zusammen hängt der zweite Treiber für den Untergang der alten SPD: ihre Erfolge. Erklärtes Ziel ihrer Politik war über Jahrzehnte, zur Befreiung aus der Proletarität beizutragen, Aufstieg durch Bildung zu organisieren, den Raum des Öffentlichen zu erweitern. Dies gelang zumindest für Teile der einstigen Arbeiterschaft, für andere jedoch nicht.
»Die gesellschaftlichen Voraussetzungen des hundert Jahre währenden Handarbeitersozialismus zerbrachen durch Aufstieg der einen, Abstieg der anderen«, so Walter. Die Herausforderung hätte nun geheißen: Harmonisierung der Interessen sowohl der einen wie der anderen in einem neuen sozialdemokratischen Projekt. Die SPD aber hat sich in der Folge mehr und mehr auf die orientiert, die im Öffentlichen Dienst oder in den besseren Facharbeiteretagen saßen. Der immer stärkeren Binnendifferenzierung dieser Milieus glaubte die Sozialdemokratie mit der Strategie Atomisierung beizukommen: für diese Gruppe diese Erleichterung, für jene Gruppe diese Offerte, für andere etwas anderes. Für die nicht Aufgestiegenen hatte die SPD bald nur noch Alimentierung im Angebot, dieses sah bei schrumpfenden Haushaltsspielräumen immer weniger wie Sozialpolitik und immer mehr wie Zwang aus.
Krise des Gestaltungsanspruchs
Wie Gesellschaftspolitik konnte es schon gar nicht wirken, und damit sind wir wieder bei Olaf Scholz. Denn wenn man nach dem Kraftstoff sucht, der in der Vergangenheit die sozialdemokratische Hoffnung antrieb, war es genau diese: eine Idee davon zu haben, wie die einzelnen Politikteile in einem größeren Ganzen sich erst richtig entfalten, den Anspruch zu haben, durch Politik Gesellschaft zu formen, nicht nur den Fehlentwicklungen und Widersprüchen hinterherzuräumen.
Die Krise der SPD ist also die Krise ihres gesellschaftspolitischen Gestaltungsanspruchs. Als um das Jahr 1973 herum die politökonomischen Bedingungen für solche Gestaltung schwieriger wurden, begann die Zeit, seit der die SPD sich und ihre Wähler*innen normativ und praktisch unterforderte. Viele wollten mehr, weil sie sich daran erinnerten, dass mehr drin ist. Die SPD hat das schneller vergessen als ihre Wähler*innen und wurde zum sozialpolitischen Lieferdienst mit wechselnden Menüs und widersprüchlichen Botschaften. Wer früh hört, den Gürtel enger schnallen zu müssen, und abends, dass die Binnennachfrage eine wichtige Konjunkturstütze ist, der hört irgendwann gar nicht mehr hin.
Natürlich, auch Franz Walter hat darauf hingewiesen, dass manchmal »Mentalitäten länger währen als die Voraussetzungen, welche ihre Entstehung ermöglichen«. Das taugt aber nicht für eine SPD-Ausrede, sondern beschreibt nur die Herausforderung sozialdemokratischer Erneuerung. Der eigentlich spannende Satz von Olaf Scholz wäre deshalb der: »Wir dürfen uns nicht kleiner machen, als wir sind.« Solange die SPD das jedoch bloß als Frage des Wettbewerbs im »rein gouvernementalen Kampf um politische Coups« versteht, wird es mit der seit etwa 1973 ausstehenden Erneuerung nichts.
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.