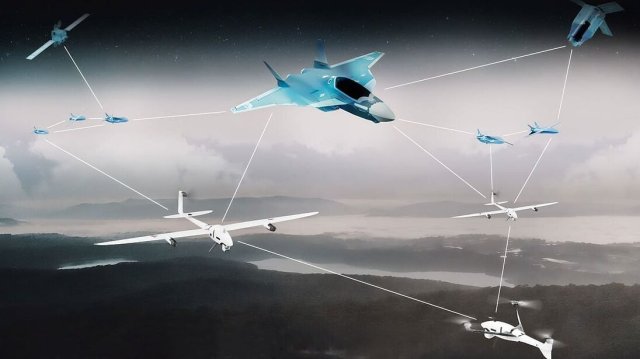- Politik
- Menschen ohne Papiere
Eine Poliklinik für Veddel
Gesundheit ist politisch: In einem Hamburger Ärztehaus werden auch Menschen ohne Papiere behandelt
Für Ibrahim war es die Rettung. Mit seinem schmerzenden Auge konnte er als Geflüchteter ohne Papiere unmöglich zu einem »normalen« Arzt in Hamburg gehen. Über Freunde hatte der 28-Jährige jedoch von der Poliklinik auf der Veddel gehört. Er fuhr hin und ihm konnte schnell geholfen werden. »Es war zum Glück nichts Schlimmes und ich brauchte nur eine Salbe«, erzählt der junge Mann, der vor acht Jahren aus Gambia nach Hamburg kam. Er gehört zu den rund zehn Prozent der Patienten, die in der Poliklinik behandelt werden, obwohl sie keine Papiere oder keine Krankenversicherung haben.
Moment mal. Eine Poliklinik? Sind diese Ärztehäuser nicht mit dem Ende der DDR verschwunden? In der Tat überdauerte der Ansatz der Polikliniken die Wende nicht lange. Die dort flächendeckende ganzheitliche ambulante medizinische Betreuung unter einem Dach war wie viele andere Konzepte aus dem der Bundesrepublik beigetretenen Staat jahrzehntelang kaum irgendwo im Westen eine Überlegung wert. Einzelne niedergelassene und frei praktizierende Ärzt*innen prägen bis heute die medizinische Landschaft in Deutschland. Vom Hausarzt erhält man die Überweisung zur Fachärztin, ohne dass diese beiden sich groß miteinander austauschen. An diesen Zustand hat man sich über die Jahrzehnte gewöhnt. In jedem Fall ist wenig Zeit für die Patienten.
»Wir wollten eine konkrete Alternative zu den derzeitigen ambulanten Versorgungsstrukturen entwickeln und gesellschaftliche Bedingungen von Gesundheit stärker in den Fokus rücken«, erzählt Anh-Thy Nguyen, eine der Mitbegründerinnen der Poliklinik. Auf der Veddel ist der reiche Hamburger Pfeffersack, sind die noblen Elbvororte und die glitzernden Fassaden der Hafencity gefühlte Lichtjahre entfernt. Zwischen Bahntrassen, Hafenbecken und der B75 breitet sich der traditionelle Arbeiterstadtteil rund um einen Fußballplatz aus. Obwohl man vom Hauptbahnhof nach nur drei Stationen und sieben Minuten Fahrt mit der S-Bahn da ist, landet man auf der Veddel in einem anderen Hamburg. Einem sichtbar ärmeren, raueren, aber auch bunteren Teil der Stadt.
Solidarisch und für alle da
Deutsch wird hier auf den Straßen selten gesprochen. Wenn man sich mit den Betreibern der Poliklinik und den Patienten unterhält, wird schnell deutlich, dass der oft verwendete Begriff »sozialer Brennpunkt« trotzdem überhaupt nicht passt. »Wir sehen die Veddel nicht als Problemviertel. Viele Menschen fühlen sich hier abgehängt und wenig gesehen. Und das muss man ändern«, fordert Nguyen. Die 36-Jährige arbeitet im Bereich Konzeption und Organisation der Poliklinik mit. Die Gynäkologin ist so etwas wie eine Aktivistin der ersten Stunde. Bereits während des Studiums trieb sie der Gedanke um, wie eine solidarische Gesundheitsversorgung aussehen könnte. Auf einem Kongress des Medibüros Hamburg - ein Praxisangebot für Menschen ohne Papiere - entstand 2013 die erste Idee für das Stadtteilgesundheitszentrum.
Eine Gruppe von Aktiven, die die Idee gemeinsam umsetzen wollten, reiste im Anschluss an den Kongress beinahe quer durch die Republik: vom ehemaligen »klassenlosen Krankenhaus« in Frankfurt am Main über die Gruppenpraxis am Hasenbergl in München bis hin zum Berliner Gesundheitszentrum Gropiusstadt besuchten die Initiatoren bestehende und ehemalige Projekte, die sich der herrschenden Marktlogik in der Medizin entziehen wollten.
Der Plan, ein eigenes solidarisches Gesundheitszentrum zu gründen, nahm immer konkretere Formen an. Standorte wurden gesucht. Die Stadtteile Horn und Billstedt waren im Gespräch, es fanden sich aber keine passenden Räumlichkeiten. Den Initiator*innen war von Anfang an klar, dass die Poliklinik in einem Gebiet entstehen sollte, in dem viele arme Menschen und Migranten leben. »Es machte wenig Sinn, die Arztdichte im tendenziell wohlhabenden Eimsbüttel noch zu erhöhen und dort zu konkurrieren, während es auf der Veddel nur eine Hausärztin und keine Apotheke gab«, sagt Nguyen, die gerade ihre Facharztausbildung absolviert.
Im Jahr 2017 war es dann so weit. Das Gesundheitszentrum bezog seinen ersten Standort im Zollhafen. Im ehemaligen Pferdestall der kasernierten Hamburger Ordnungspolizei entstanden die ersten Praxisräume. Ein Jahr darauf trat die einzige Hausärztin auf der Veddel an die Poliklinik heran. Altersbedingt wollte sie ihre Praxis aufgeben. Die Gründer*innen der Poliklinik überlegten nicht lange und übernahmen die Praxis kurzerhand. Jüngst kam dann noch ein dritter Standort hinzu, an dem die psychologische Beratung stattfindet und eine Hebamme Schwangere empfängt.
Alle drei Standorte erreicht man durch einen kurzen Fußmarsch - die Veddel ist nicht groß. Mittlerweile arbeiten 25 Menschen unterschiedlichster Professionen in der Poliklinik: Ärzt*innen, Psycholog*innen, Sozialarbeiter*innen, einer Soziologin und eine Hebamme. Und dann gibt es noch zwei »CHN«. Das Kürzel steht für »Community Health Nurse«. Hinter dem sperrigen englischen Begriff verbirgt sich nichts anderes als die Gemeindeschwester. Gab es die nicht auch schon mal irgendwo? Ja, auch in der DDR versorgten ausgebildete Pflegekräfte Patient*innen, indem sie sie auch zu Hause häufig aufsuchten, vor allem im ländlichen Raum, aber auch in städtischen Wohnbezirken. Sie waren Ansprechpartnerinnen für die kleinen und großen Belange. Sie bezogen die zuständigen Hausärzte meist nur bei schwereren Erkrankungen ein.
Begleitet durch ein Forschungsprojekt der Hochschule für Angewandte Wissenschaften wird der Einsatz der CHN gerade evaluiert. Auf der Veddel sind diese jedoch keine ausgebildeten Pflegekräfte mehr, sondern studierte Pflegewissenschaftlerinnen. Für zwei Jahre sind die Stellen zunächst über das Projekt gesichert. Danach würden es die Initiatoren der Poliklinik begrüßen, wenn die Arbeit der CHN eine regelhafte Leistung für ein Stadtteilgesundheitszentrum wäre. Denn sie leisten einen Großteil der aufsuchenden Arbeit: Sie machen Hausbesuche, besprechen mit den Patient*innen ihre Sorgen und Nöte und stellen sicher, dass gesellschaftliche Faktoren von Krankheit nicht übersehen werden.
Marode Wohnsubstanz
Die Veddel hat nämlich bei allem Charme auch ein massives Problem mit marodem Wohnungsbestand. »Im zurückliegenden Jahr war ich stark damit beschäftigt, zusammen mit den Nachbarinnen das Schimmelproblem vieler Wohnungen anzugehen. Darüber hinaus konnten wir den Abriss eines Hauses verhindern, in dem viele Menschen zu günstigen Mieten wohnen können«, erzählt Tina Röthig, die für den Bereich Gemeinwesenarbeit im Projekt zuständig ist.
Der Arbeit von Röthig merkt man deutlich den Ansatz des Stadtteilgesundheitszentrums an. Die Menschen, die hier arbeiten, glauben nicht, dass nur Mediziner*innen für die Gesundheitsversorgung der Bewohner zuständig sein sollten. Hier ist man der Meinung, dass auch das Konzept »Patienten helfen Patienten« von Bedeutung ist. An allen Ecken und Enden wird multiprofessionell gedacht und auf den regelmäßigen Plena kollektiv entschieden, wie sich das Projekt weiterentwickelt. Und wieder so ein Begriff, der wirkt, wie aus der Zeit gefallen: Kollektiv. Doch alle Beteiligten finden den Kollektivgedanken wichtig, finden ihn zeitgemäß und gar nicht verstaubt.
Künftig ist auch geplant, dass es eine Angleichung bei den Löhnen geben soll, um die Hierarchien auch auf finanzieller Ebene flacher zu gestalten. »Es wird dann jedoch aller Voraussicht nach am schwierigsten, Ärzte zu gewinnen«, räumt Nguyen ein. Denn sie würden im Vergleich zu einer Tätigkeit in einem Krankenhaus oder einer Praxis auf den größten Anteil ihres Lohnes verzichten müssen. Doch noch ist dieser Gedanke Zukunftsmusik. Wirkt so viel politischer Anspruch nicht zu ambitioniert? Und ist die Poliklinik damit nicht so etwas wie ein Raumschiff, das auf der Veddel gelandet ist? Tatsächlich wohnt niemand aus dem Team der Poliklinik selbst hier. »Zu Beginn kamen wir schon von außen. Aber mittlerweile wachsen wir mehr und mehr in den Stadtteil hinein«, sagt Tina Röthig. Vertrauen ist entstanden - und es wird nicht mehr nur allein auf den Arzt gehört. Das Konzept, dass Patient*innen und Behandelnde auf Augenhöhe miteinander sprechen, kommt gut an. Zu explizit politischen Veranstaltungen kamen in den letzten Jahren hingegen nur wenige Anwohner*innen.
Ganz anders als zu den Impfangeboten, die die Poliklinik auf die Beine gestellt hat. »Von Mai bis September haben wir im letzten Jahr in den Räumen der AWO ein Impfzentrum betrieben. Das ist jetzt in die Poliklinik umgezogen«, erzählt Tobias Filmar, der als Koordinator für multiprofessionelle Zusammenarbeit bei der Poliklinik arbeitet. Als Psychologe und ausgebildeter systemischer Berater bietet er auch Beratungen am Standort in der Veddeler Brückenstraße an. »Insgesamt arbeiten vier Psychologen und Sozialpädagogen bei uns, die alle als systemische Berater weitergebildet sind«, erklärt Filmar.
Das Impfangebot wird nach wie vor gut angenommen. Den ganzen Mittwoch über stehen Menschen an, die auf ihre Erst-, Zweit- oder Boosterimpfung warten. So wie Melek. Die 37-Jährige wartet zusammen mit ihrer Tochter Sara in der Praxis am Zollhafen auf ihre Impfung. »Ich bekomme heute meine zweite Impfung, während meine Mutter geboostert wird«, erzählt die 16-jährige Sara. Die beiden sind begeistert, dass es die Poliklinik bei ihnen im Stadtteil gibt. Noch haben sie eine andere Hausärztin weiter weg, können sich aber perspektivisch einen Wechsel auf die Veddel vorstellen.
Nina, die ihren wirklichen Namen nicht in der Zeitung sehen möchte, kommt ebenfalls zum Impfen vorbei. Sie ist während des Studiums auf die Veddel gezogen und danach als einige der wenigen geblieben. Zu Beginn fühlte sie sich beinahe als die »einzige Deutsche« im Stadtteil - mittlerweile lebt sie mittendrin und denkt schon längst nicht mehr in Kategorien wie »deutsch« und »nicht deutsch«. Dann schon eher »wir Veddeler« - ein Dorf mit seinen rund 4300 Einwohnern, die sich immer etwas allein am Rande und mitunter vergessen fühlen. Die AfD bekam hier trotzdem oder gerade deshalb bislang bei Wahlen immer weniger als fünf Prozent der Stimmen.
Die Poliklinik ist nicht allein: Sie ist seit ihrer Gründung Teil des Poliklinik Syndikat. In Berlin, Leipzig, Köln und Dresden gibt es ähnliche Projekte, die sich darin zusammengeschlossen haben. Einige Projekte laufen bereits, andere sind noch im Planungsstatus. Allen gemeinsam ist neben einem schier unbändigen Idealismus die noch recht wackelige Finanzierung. Denn trotz aller Ansprüche sind auch die Polikliniken gezwungenermaßen Teil des durchökonomisierten Gesundheitssektors. »Wir bekommen im Augenblick neben den bei den Krankenkassen abgerechneten Leistungen Gelder aus Töpfen von Stiftungen und weiteren Drittmitteln«, erklärt Filmar. Da bleibt es nicht aus, dass sich alle Beteiligten auch ein Stück weit selbst ausbeuten. Denn die allermeisten, die in die Poliklinik kommen, sind Kassenpatiente*innen - neben den erwähnten rund zehn Prozent, die über gar keine Krankenversicherung verfügen.
Wegen des deutschen Gesundheitssystems droht hier eine Schieflage, weil eben Privatpatient*innen fehlen, die zur »Querfinanzierung« von Praxen gebraucht werden. Die findet man auf der Veddel so gut wie gar nicht. So bleibt unterm Strich nur die Hoffnung, dass auch die Stadt Hamburg erkennt, welche Vorteile ein Gesundheitszentrum hat, in dem nicht nur durch die Medizinerbrille auf Krankheit und Gesundheit geschaut wird. Ein bisschen Bewegung ist schon erkennbar: Der rot-grüne Senat setzt eigentlich seit Jahren auf interdisziplinäre Gesundheitszentren für benachteiligte Stadtteile. Doch bislang ist keines dieser Zentren realisiert worden. Es finden sich einfach keine Haus- und Kinderärzt*innen, die in ein solches Projekt einsteigen möchten. Gegenwind bekommt der Senat auch von der Hamburger Kassenärztlichen Vereinigung. Deren Chef Walter Plassmann betonte bereits, die KV werde die Pläne des Senats nicht unterstützen. So bleibt die Poliklinik wohl vorerst allein auf weiter Flur.
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.