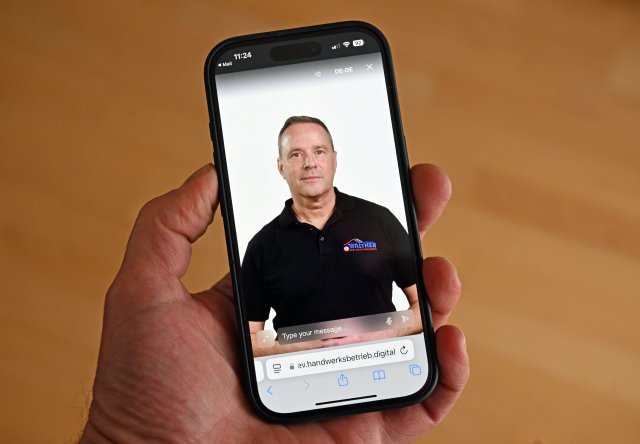- Wirtschaft und Umwelt
- Finanzinstitutionen
Das Multi-Krisentreffen
Selten musste sich eine Tagung von IWF und Weltbank um so viele Baustellen gleichzeitig kümmern
»Inmitten der Düsternis von Krieg, Inflation, Energiekrise und zunehmender Verschuldung gibt es auf der diesjährigen Frühjahrstagung viel zu besprechen«, schreibt der britische Thinktank OMFIF mit Blick auf die Tagung der Weltbank und des Internationalen Währungsfonds (IWF), die am Montag in Washington begonnen hat. IWF-Chefin Kristalina Georgieva beschwört daher den Geist der Gründung der beiden Institutionen: Die aktuelle Situation erinnere sie »an Bretton Woods im Jahr 1944, als im Schatten des Krieges die führenden Politiker zusammenkamen, um eine bessere Welt zu schaffen«, erklärt Georgieva. »Es war ein Moment von beispiellosem Mut und Zusammenarbeit.« Genau das sei auch heute wieder nötig.
In der aktuellen Multikrise lassen sich drei Phasen unterscheiden: Erst kam die Corona-Pandemie, die viele ärmere Länder in extreme finanzielle Nöte getrieben hat. Die Weltbank schätzt, dass die Schulden der Entwicklungsländer mittlerweile auf einem 50-Jahre-Hoch sind.
Die zweite Phase war dann die Antwort der Industriestaaten auf die Coronakrise, die negative Auswirkungen auf die ärmeren Länder hatte. Weltbank-Chef David Malpass sagte: »Die außerordentlichen geld- und fiskalpolitischen Maßnahmen, die die fortgeschrittenen Volkswirtschaften zur Ankurbelung ihrer Nachfrage ergriffen haben, kombiniert mit unterbrochenen Lieferketten, haben den Preisanstieg angeheizt und die Ungleichheit weltweit verschärft.« Erst Corona und dann Inflation.
Die dritte Phase begann schließlich mit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Dieser habe negative Konsequenzen für den Großteil der Welt und nicht nur für die direkt betroffenen Staaten, sagt IWF-Chefin Georgieva: »Die Auswirkungen des Krieges werden in diesem Jahr zu einer Herabstufung der Prognosen für 143 Volkswirtschaften beitragen, die 86 Prozent der weltweiten Wirtschaftsleistung ausmachen.«
Hinter dieser Zahl verbirgt sich nicht weniger als eine humanitäre Katastrophe: Die Entwicklungsorganisation Oxfam schätzt, dass allein die steigenden Lebensmittelpreise dieses Jahr 263 Millionen Menschen zusätzlich in absolute Armut stürzen werden. Bis Ende des Jahres werden dann mit weniger als 1,90 Dollar pro Tag 860 Millionen Menschen auskommen müssen - das wäre jeder zehnte Erdenbewohner.
Hinzu kommt, dass viele Länder derzeit Maßnahmen ergreifen, die die Hungerkrise noch verschlimmern. »Innerhalb weniger Wochen ist die Zahl der Länder, die Ausfuhrbeschränkungen für Lebensmittel verhängen, um ein Viertel auf 35 gestiegen«, beklagt der Weltbank-Chef. Noch sei das Problem aber nicht so groß wie in der Lebensmittelpreiskrise von 2008 bis 2011, die zur Entstehung des Arabischen Frühlings beitrug. Und genau deshalb müsse der Trend zu Exportkontrollen für Lebensmittel sofort gestoppt werden, fordert Malpass. »Die meisten Handelshemmnisse schützen die Privilegierten auf Kosten des Rests der Gesellschaft und verschärfen die Ungleichheit. Dazu gehören Quoten, hohe Zölle, hohe Exportsteuern und Subventionen, die den Handel verzerren.«
IWF-Kollegin Georgieva beklagt ein zusätzliches Problem: den abnehmenden Willen zu multilateraler Zusammenarbeit. »In einer Welt, in der ein Krieg in Europa Hunger in Afrika verursacht, in der eine Pandemie innerhalb von Tagen um den Globus kreisen kann, in der Emissionen irgendwo überall einen Anstieg des Meeresspiegels bedeuten, kann die Bedrohung unseres kollektiven Wohlstands durch einen Zusammenbruch der globalen Kooperation gar nicht zu hoch eingeschätzt werden.« Doch genau diese Zusammenarbeit droht zum Opfer des Krieges in der Ukraine und der zunehmenden Spannungen zwischen den USA und China zu werden. Georgieva mahnt daher: »Das einzige wirksame Mittel gegen diese Risiken ist die internationale Zusammenarbeit. Sie ist unsere einzige Hoffnung auf eine gerechtere, widerstandsfähigere Zukunft. Und sie ist unsere Pflicht.« Bei der Frühjahrstagung gibt es also tatsächlich viel zu besprechen.
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.