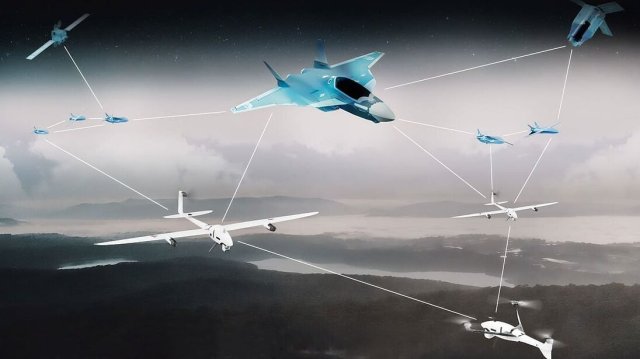- Politik
- Ampel-Koalition
Abstiegsangst regiert mit
Die friedlichen Zeiten in der Koalition sind vorbei
Die Zeit der freundlichen Selfies, die Grüne und FDP während der Koalitionsverhandlungen gemacht hatten, sind vorbei. Stattdessen sind kurz vor der parlamentarischen Sommerpause die Gegensätze in der Bundesregierung deutlich zutage getreten. Die Zukunft des Verbrennungsmotors, die mögliche Wiederbelebung der Atomenergie und die Einhaltung der sogenannten Schuldenbremse sind nur drei Themen, bei denen es Streit gibt. Nun ruht das parlamentarische Geschehen seit einer Woche. Die Protagonisten der Koalition werden diese Zeit nutzen, um mit eigenen Vorstößen zur Krisenpolitik im Gespräch zu bleiben. Dafür gibt es unter anderem die Sommerinterviews in den öffentlich-rechtlichen Sendern.
Regieren ist in Deutschland auch mit Gefahren verbunden. Wer aus Sicht vieler Bürger beziehungsweise der großen Medien zu spät oder falsch auf Krisen reagiert, dessen Beliebtheitswerte sinken rapide. FDP-Chef Christian Lindner hat das auf eine simple Formel gebracht: »Es ist besser, nicht zu regieren, als schlecht zu regieren.« Deswegen hatte er sich vor bald fünf Jahren gegen ein Bündnis mit Union und Grünen entschieden. Die FDP hätte in dieser Konstellation zu wenig eigene Inhalte durchsetzen können, so die Sorge von Lindner. Stattdessen musste die SPD einspringen und quälte sich zunächst erneut in die Große Koalition, aus der sie aber letztlich erfolgreich herausgegangen ist, wenn man sich das Ergebnis der vergangenen Bundestagswahl ansieht.
Was Angela Merkel nicht gelungen ist, hat der SPD-Politiker Olaf Scholz geschafft. Er hat Lindner und seine FDP von einem Dreierbündnis überzeugen können. Insgesamt hat Scholz es nicht leicht mit der FDP. Insbesondere die Attacken von Lindner nehmen zu. Er trommelt für längere Laufzeiten der Atomkraftwerke und will die Förderungen bei Langzeitarbeitslosen kürzen. Außerdem wurde kürzlich bekannt, dass der FDP-Chef einen »Brandbrief« an Scholz und Verteidigungsministerin Christine Lambrecht geschrieben hat, in dem es um die Aufrüstung der Bundeswehr geht. Lindner wacht als Finanzminister über das Geld. Deswegen meinte er, Lambrecht auffordern zu können, schnell den pannenbehafteten Einkauf bei der Bundeswehr effizienter zu gestalten. Ihm gehe es um den »Zustand der Streitkräfte«, so der FDP-Minister. Jemand hat dem »Spiegel« diesen Brief zugesteckt. Es ist nicht schwer zu erraten, wer ein Interesse daran hat, dass sich Lindner derart wichtig tut in der Koalition: der FDP-Vorsitzende selber.
Denn ihm steckt noch immer die Existenzangst in den Knochen. Lindner hat die schweren Zeiten seiner Partei miterlebt, die 2013 aus dem Bundestag gewählt wurde. Sie war damals in nur noch neun Landtagen vertreten. Lindner hielt in Nordrhein-Westfalen die Stellung und baute die Bundespartei wieder auf. Er weiß, dass die Konkurrenzsituation geblieben ist. Das große und mittelständische Kapital sieht sich zuweilen von Teilen der Union und der AfD besser vertreten als von der FDP. Dass sich die CDU für Friedrich Merz als neuen Chef entschieden hat, war auch eine strategische Entscheidung. Der frühere Blackrock-Lobbyist verkörpert so ziemlich alles, was sich auch Wähler der FDP wünschen, nämlich einen Staat, der Unternehmen keine großen Vorgaben macht, die notwendige Infrastruktur bereitstellt und militärisch aufrüstet, wenn das angesichts der Weltlage und der umkämpften Märkte als notwendig angesehen wird.
Umfragen sehen die Union mittlerweile bei 25 bis 27 Prozent auf Platz eins. Die FDP steht nur noch bei sechs bis acht Prozent. Sie hat zudem große Verluste bei den Wahlen in Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein erlitten. In beiden Ländern sind die Freien Demokraten aus der Regierung geflogen. Stattdessen koalieren dort nun CDU und Grüne miteinander.
Auch in der SPD wissen die Politiker, wie es ist, wenn man in den Abgrund blickt. In Teilen von Süd- und Ostdeutschland stecken die Sozialdemokraten schon seit Jahren in der Krise. Bundesweit scheinen die Zeiten vorbei zu sein, in denen sie über 30 Prozent kommen. Trotzdem ist die SPD im Unterschied zu einigen europäischen Schwesterparteien wie etwa in Griechenland oder in Frankreich nicht erodiert. Ein wichtiger Grund hierfür sind die engen Verbindungen zwischen den Sozialdemokraten und vielen gewerkschaftlich organisierten Beschäftigten. SPD-Mitglieder dominieren die Führungen der DGB-Gewerkschaften. Seit ihrer Abkehr von der neoliberalen Agendapolitik hat sich das Verhältnis zwischen den Sozialdemokraten und den Gewerkschaften wieder verbessert.
Allerdings bröckelt angesichts der Krisen das Versprechen, dass das Modell der Sozialpartnerschaft, wonach Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften ihre Interessensgegensätze durch die Suche nach einem Konsens lösen, zu einer Politik führt, die zum Wohle aller Beteiligten ist. Denn kleine Lohnsteigerungen werden die Preisexplosionen nicht ausgleichen. Die SPD versucht, sich mit Entlastungspaketen und Einmalzahlungen durch die Krise zu hangeln. Eine langfristige Möglichkeit wäre die Deckelung der Preise bei Energie und Produkten des täglichen Bedarfs. Aber diesbezüglich wird es schwierig, einen Konsens in der Koalition zu finden. Geht es nach der FDP, soll der Markt nahezu alles regeln. Staatliche Eingriffe gelten für sie als Teufelszeug. Allerdings macht sie zuweilen Ausnahmen, wenn die eigene Klientel bedient wird. Ein Beispiel hierfür war die Senkung der Spritpreise mithilfe des Tankrabattes.
Für die SPD wird es immer schwieriger, ihr Versprechen einer »sozialen Politik« umzusetzen. Die Diakonie wies kürzlich auf Prognosen hin, wonach wegen der Inflation und der Folgen der Corona-Pandemie im Jahr 2024 jede vierte Person von Armut betroffen sein könnte. Auch in Teilen der SPD-Klientel dürfte sich die Abstiegsangst ausbreiten. Umfragen sehen die Partei nur noch bei 19 bis 21 Prozent. Wer davon profitiert und ob die Krise womöglich eine Chance für die bislang zerstrittene Linkspartei ist, bleibt derzeit noch offen.
Wesentlich besser stehen die Grünen da. Sie liegen in Erhebungen zwischen Union und SPD auf dem zweiten Platz. Außenministerin Annalena Baerbock und Wirtschaftsressortchef Robert Habeck rangieren oft auf den ersten Plätzen der beliebtesten Politiker. Dabei tun sie zuweilen das Gegenteil von dem, was sie im Wahlkampf versprochen haben. Nachdem die Grünen zusammen mit Politikern der FDP verlangt haben, dass schweres Kriegsgerät in die Ukraine geliefert wird, nehmen die deutschen Waffenlieferungen zu. Vor der Wahl hatten die Grünen noch angekündigt, Rüstungsexporte massiv einschränken zu wollen, wobei Habeck bereits vor dem russischen Angriff auf die Ukraine eine Minderheitenposition in der Partei vertreten und Kriegsunterstützung für Kiew, damals noch für den Kampf mit Separatisten im Osten, gefordert hatte.
Aber die führenden Politiker der Partei müssen sich keine Sorgen machen, deswegen abgestraft zu werden. Unter den Wählern der Grünen gibt es so gut wie keine Pazifisten mehr. Auch diejenigen, die Maximalforderungen in der Klima- und Umweltpolitik stellen, haben keinen großen Einfluss. Zwar werden die erneuerbaren Energien ausgebaut, aber die Grünen haben sich wegen des Gasstreits mit Russland auch dafür entschieden, auf Kohlekraftwerke zu setzen. Natürlich gibt es deswegen Ärger mit Fridays for Future und Luisa Neubauer. Aber austreten würde sie deswegen nicht aus der Partei. So halten auch einige interne Kritiker den Grünen weiter die Stange. Alternativen sehen sie derzeit nicht.
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.