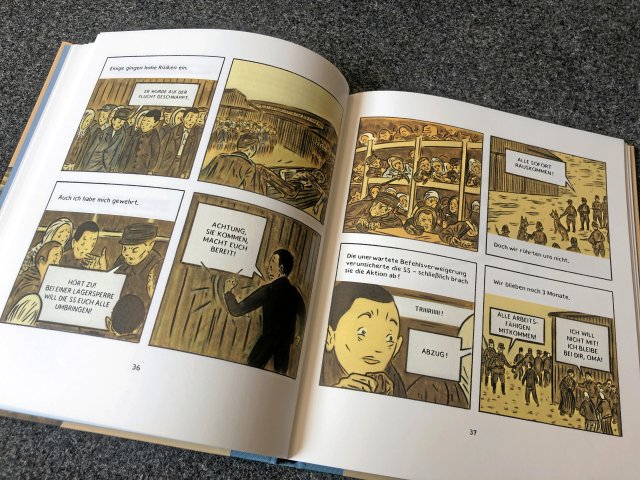- Berlin
- Städtebau
Berlin: Wo Architektur der Obdachlosigkeit Feind ist
Mit »Hostile Design« wird die Stadt im Kleinen systematisch ungemütlich gemacht

Der 2018 neu gestaltete Steinplatz in der Charlottenburger City West, gegenüber der Universität der Künste, ist ansehnlich. Eine Rasenfläche in der Mitte, Bänke rundherum, junge Bäume: Der Platz ist sauber und ordentlich. Früher war der kleine Park noch von einem drei Meter breiten Gebüsch umgeben. Ein Rückzugsort, der keinen Einblick gewährte. »Obdachlose haben hier gerne geschlafen, sich mal mit einer Wasserflasche gewaschen, sich mal umgezogen«, erklärt der 55-jährige Dieter Bichler, der eigentlich nur »Meru« genannt werden will. Meru, als Kurzform von »meine Ruhe«, weil er sich von nichts aus dem Konzept bringen lässt. Meru war selbst obdachlos und macht seit mehr als zehn Jahren Stadtführungen für den Verein Querstadtein. Er zeigt den Kiez, in dem er früher auf der Straße gelebt hat.
Die neuen Bänke auf dem sauberen Steinplatz sehen zwar schön aus, sind für Obdachlose aber problematisch. »Die alten Bänke waren perfekt zum Schlafen«, meint Meru. Auf den neuen, die eine gekrümmte Sitzfläche haben, sei die Sitzfläche so schmal, dass man, wenn man darauf schlafe, einfach vorne herunterfalle. Was zunächst wie ein Versehen daherkommt, wird »Hostile Design« genannt, auf Deutsch manchmal auch »defensive Architektur«. Aber defensiv ist an der Gestaltung von Gegenständen des öffentlichen Raums wenig, es geht um Verhaltenskontrolle und Vertreibung.
Martin Binder ist Künstler und beschäftigt sich schon seit mehr als zehn Jahren mit dem Thema Hostile Design. Früher hat er für ein Designbüro gearbeitet, das unter anderem auch für ein großes »Stadtmöblierungsunternehmen« tätig ist. »Sehr viele Menschen arbeiten daran, Verhaltensweisen zu verhindern«, sagt er. Aber das werde nicht explizit gesagt. »Bei Ausschreibungen werden Kriterien aufgestellt, etwa dass etwas ›vandalismussicher‹ sein soll. Große Firmen geben dann Aufträge an Designer mit entsprechenden Erwartungen.«
Binder nennt klassische Beispiele: aufgeteilte Sitzflächen, auf denen man sich dann nicht hinlegen kann. Anlehnhilfen, die nicht einmal mehr richtige Bänke sind, sondern auf Hüfthöhe angebracht sind. »Es gibt auch richtig extreme Stacheln auf Lüftungsschächten«, ergänzt er. »Oder so etwas wie klassische Musik an Bahnhöfen. Da denkt man im ersten Moment ja auch nicht, dass das Leute vertreiben soll.« An Orten, an denen sich viele suchtkranke Menschen aufhalten, werde manchmal blaues Licht installiert, so Binder weiter.
Dazu bekennen, welchen Zweck ein architektonischer Entwurf im öffentlichen Raum hat, will sich in den seltensten Fällen jemand. »Niemand will die Person sein, die sich dazu öffentlich äußert«, meint Binder. Eine Anfrage an den Senat von dem stadtpolitischen Sprecher der Grünenfraktion Julian Schwarze aus 2023 zum Thema zeigt dies anschaulich. Die Antwort ist wenig erhellend: Metallstreben auf Abluftgittern am Alexanderplatz benötigten keine Baugenehmigung; Metallpyramiden auf Betonpollern am Ostbahnhof befänden sich auf Privatgelände, so der Senat.
Ausnahmen bestätigen die Regel: Markus van Stegen, Leiter der Polizeidirektion 5, wurde Anfang Februar von der »Berliner Zeitung« mit dem Vorschlag zitiert, an den U-Bahnhöfen Berlins Drehkreuze und andere Formen von Zugangskontrollen einzuführen, damit man nur noch mit gültigem Ticket den Bahnsteig betreten kann. Damit knüpft van Stegen an immer wieder aufkommende Diskussionen über U-Bahnhöfe an: zu viele Obdachlose, zu viele Suchtkranke. Der »Tagesspiegel« titelte »Dreck, Drogen, Obdachlosigkeit: Wie die BVG Berliner U-Bahnhöfe sauberer machen will«.
Manchmal wird öffentlicher Raum aber durch Aufwertung unbenutzbar gemacht. Die Unterführung der Bleibtreu-Straße direkt am Savignyplatz ist ein Beispiel dafür. 2013 wurden drei Brücken in der City West zu einer »Perlenkette aus Licht« umgestaltet. Die ehemals dunklen Brücken wurden erleuchtet. Einerseits schön, andererseits war die Unterführung ein Ort, an dem man vor Wind, Wetter und feindseligen Menschen sicher schlafen konnte. Die Lichtinstallation, die unter der S-Bahn-Brücke einen Kreis zieht, hat 2014 den deutschen Lichtdesign-Preis gewonnen. Sie reagiert dynamisch auf Bewegungsmelder und ändert Farbe und Intensität in wechselndem Rhythmus. Zusätzlich läuft aber ab null Uhr klassische Musik. Meru erzählt: »Wenn da Musik dudelt und das Licht enorm hell wird, kannst du nicht mehr schlafen.«
Halbwegs warme und sichere Orte sind enorm wichtig für Menschen, die auf der Straße leben. Kälte ist neben Suchtkrankheiten eine der größten Gefahren, denen sie ausgesetzt sind. Als Meru obdachlos war, schloss er sich einer Gruppe an. Von den ursprünglich acht Menschen sind nur noch zwei am Leben. Die anderen sind alle bis 2014, innerhalb von zwei Jahren, ums Leben gekommen. Drei seiner ehemaligen Kompagnons sind am Alkohol zugrunde gegangen, eine Begleiterin erfror in einer Bushaltestelle, eine starb an einer Überdosis Crystal Meth und eine wurde in ihrem Schlafsack angezündet.
Wärme alleine reicht offensichtlich nicht. Selbst wenn ein halbwegs warmer Platz gefunden ist, drohen auf der Straße noch viele andere lebensbedrohliche Gefahren. Das wird auch an Merus eigener Erfahrung deutlich. »In einer Nacht habe ich Pech gehabt«, erzählt er lakonisch. Er wurde am Savignyplatz aus dem Schlaf gerissen und »von acht Schuhen zusammengetreten«, wie er beschreibt. Neben sieben ausgeschlagenen Zähnen, die noch immer nicht ersetzt sind, waren ein zweifacher Kieferbruch, fünf gebrochene Rippen und mehr als 200 Prellungen die Folgen des Überfalls. Meru hatte noch Glück. Ein älteres Ehepaar fand ihn blutend im Schnee. Ein Folge der Gestaltung des Platzes? Nein. Aber jeder sichere Schlafplatz weniger macht das Risiko größer, angegriffen zu werden.
Die kleinen Gestaltungsfragen um eine Unterführung, einen Platz oder eine Parkbank führen schnell zu größeren Fragen. Mit jeder unbequemen Bank gibt es einen Ort weniger in der Stadt, an dem man sich aufhalten kann, ohne konsumieren zu müssen. Binder sagt: »Wenn selbst Sitzgelegenheiten wegfallen, mutieren Innenstädte zu reinen Konsumorten.«
Soziale Probleme lassen sich nicht »wegdesignen«. »Klar, niemand möchte beispielsweise, dass Leute vor der eigenen Tür Drogen konsumieren«, meint Binder. Aber man könne versuchen, Lösungen zu finden. Was zurzeit passiere, sei einfach nur ein Verdrängungsmechanismus. »Die Frage sollte viel eher sein, wie man eine Stadt für alle einladend machen könnte. Das macht dann auch viel mehr Spaß.« Auch Meru hat eine klare Position: »Der öffentliche Raum gehört doch uns. Wenn wir uns alle gegenseitig ein bisschen mehr akzeptieren würden, würde dieser ganze Quatsch von defensiver Architektur nicht existieren.«
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.