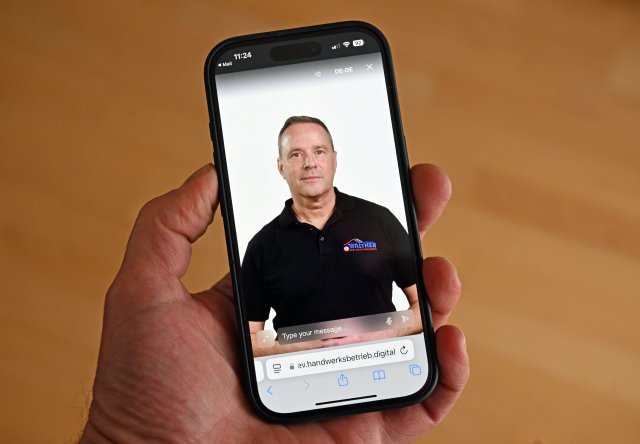- Wirtschaft und Umwelt
- Pflege
Alzheimer-Krankheit: »Mitleid ist demütigend«
Katrin Seyfert hat ihren Mann gepflegt, der recht jung an Alzheimer erkrankt war. Sie musste lernen, mit dem Schicksal umzugehen

Frau Seyfert, Sie waren 45 Jahre alt, als bei Ihrem erst 53 Jahre alten Mann Alzheimer diagnostiziert wurde. Ein extrem seltener Fall. Als die Krankheit schnell voranschritt, riet Ihnen ein Arzt, Ihren Mann wie ein Möbelstück zu betrachten. Haben Sie diesen Rat befolgt?
Nein. Aber jetzt, eineinhalb Jahre nach dem Tod meines Mannes, verstehe ich, was der wohlwollende Arzt meinte. Er meinte, dass ich lernen müsse, mich auch ein Stück weit zu separieren und auf mich selbst zu achten.
Wie ändert sich eine Liebesbeziehung, wenn ein Partner an Alzheimer erkrankt?
Wenn ein Partner an Alzheimer erkrankt, wird aus einer Liebesbeziehung eine Betreuungssituation. Sobald die Krankheit ein gewisses Stadium erreicht hat, begegnet man sich als Paar nicht mehr auf Augenhöhe. Ich habe meinen Mann bis zum Ende geliebt, aber es war eine andere Liebe als früher. Wenn man den Partner nicht mehr um Rat fragen kann, wird aus der Augenhöhen-Liebe eine fürsorgliche Liebe.

Katrin Seyfert (53) hat eigentlich einen anderen Namen, schreibt aber unter einem Pseudonym, um die Privatsphäre ihrer Kinder zu schützen. Die Journalistin war 45 Jahre alt, als bei ihrem Mann Alzheimer diagnostiziert wurde, und 51 Jahre, als er daran starb. Sie lebt mit ihren Söhnen (18 und 16) und ihrer Tochter (14) in Hamburg. Über die Krankheit, das Sterben und den Tod ihres Mannes hat sie jetzt das Buch »Lückenleben. Mein Mann, der Alzheimer, die Konventionen und ich« geschrieben.
Eine ähnliche Liebe, wie Eltern sie für ihre Kinder empfinden?
Nein, denn bei Kindern sieht man stets einen Fortschritt. Nachdem man ihnen 37-mal die Schnürsenkel gebunden hat, machen sie es beim 38. Mal selbst – und man freut sich. Bei Alzheimer ist es genau andersrum. Man kann dabei zugucken, wie der Partner immer weniger kann.
Hat Ihr Mann irgendwann vergessen, dass er Sie liebt?
Nein. Nein. (Lächelt) Zum Glück hat er mir und den Kindern das Geschenk gemacht, dass er uns bis zu seinem Schluss erkannt hat.
Erkennen heißt nicht lieben.
Ich weiß, dass er mich bis zuletzt geliebt hat. Dafür habe ich sogar einen Videobeweis. Wenige Tage vor seinem Tod hat meine Tochter meinen Mann mit dem Handy gefilmt und ihn gefragt: »Papa, hast du Mama lieb?« Und er hat geantwortet: »Ganz doll, ganz doll!«. Es ist das letzte Video, das ich von meinem Mann habe.
Über die Liebe zu Ihrem an Alzheimer verstorbenen Mann haben Sie jetzt das Buch »Lückenleben« geschrieben. Darin heißt es, dass Sie wie Prinzessin Diana und Prinz Charles eine Ehe zu dritt geführt haben. Bei Ihnen war nicht Camilla, sondern Alzheimer die Nebenbuhlerin. Hat die Krankheit in dieser Dreierbeziehung irgendwann die Oberhand gewonnen?
Ja. Spätestens ab dem Zeitpunkt, an dem ich Entscheidungen über den Kopf meines Mannes hinweg fällen musste, hatte die Krankheit mich komplett zur Seite gedrängt. Irgendwann musste ich entscheiden, dass mein Mann nicht mehr Auto fahren darf. Irgendwann musste ich entscheiden, dass ich die EC-Karte meines Mannes verwalte. Und irgendwann habe nicht nur ich über meinen Mann entschieden, sondern die Krankheit auch über mich.
Wie hat die Krankheit über Sie bestimmt?
Wenige Wochen vor dem Tod meines Mannes sagte meine damals zwölfjährige Tochter zu mir: »Mama, Papa hat immer gesagt, er geht ins Heim, wenn er uns Kindern nicht mehr guttut. Jetzt tut er uns nicht mehr gut.« Weder meine Tochter noch ich haben entschieden, meinen Mann ins Heim zu geben. Die Krankheit hat über uns alle hinweg entschieden.
Sie haben Ihren Mann fünf Jahre lang gepflegt, sich währenddessen um Ihre drei Kinder gekümmert und waren voll berufstätig. Viele Menschen haben Sie deshalb bemitleidet. Hat Ihnen das geholfen?
Nein! Nein! Wobei? Vielleicht doch! Denn Mitleid hat mich wütend gemacht. Und Wut kann eine gute Kraftquelle sein. Außerdem war ich wütend wahrscheinlich sozialverträglicher. Ich habe während der Krankheit meines Mannes viel gepöbelt. Pöbeln kann man leichter ertragen als Wehleidigkeit.
Warum hat Mitleid Sie wütend gemacht?
Mitleid ist demütigend, weil es immer von oben nach unten geht. Man sagt ja nie: »Ach, Heiliger Vater, Sie haben aber ein Tagespensum. Sie tun mir leid.« Und der Chefarzt bemitleidet die Krankenschwester, nicht umgekehrt.
Sie schreiben, dass es hochmütig machen kann, jemanden zu pflegen. Hat Alzheimer Sie hochmütig gemacht?
Ja, Alzheimer hat mich hochmütig gemacht. Wenn andere mir von ihren scheinbaren Pillepalle-Problemen wie einem eingewachsenen Zehennagel erzählen, muss ich mich erst mal zurücknehmen und mir klarmachen, dass für jeden Menschen erst mal das eigene Problem das größte ist. Aber ich merke, dass dieser Hochmut zum Glück mit der Deadrinalisierung, die sich bei mir seit dem Tod meines Mannes langsam einstellt, abnimmt und ich gnädiger werde.
Sie und Ihre Kinder haben sich lange dagegen gewehrt, Ihren Mann in ein Heim zu bringen. Was gab letztendlich den Ausschlag, es doch zu tun?
Schon ein Jahr vor unserer Entscheidung hatte mein Mann sich auf einem seiner Spaziergänge verlaufen und wurde 37 Stunden vermisst. Er wurde von der Polizei mit einer Hundestaffel und Drohnen gesucht, wir haben ihn unter anderem über Facebook gesucht. Überall in der Hamburger U-Bahn wurde seine Vermisstenanzeige gezeigt. Schließlich wurde er wohlbehalten an einem Ort, 25 Kilometer entfernt von unserem Haus gefunden.
Weil Ihr Mann weglief, musste er ins Heim?
Nein. Ins Heim kam er erst anderthalb Jahre später. Es war die große Summe der vielen großen und kleinen Anlässe. Wie viele Sandkörner machen einen Haufen? Zehn oder 15 sicher nicht. Aber irgendwann ist ein Haufen ein Haufen. Irgendwann mussten wir uns eingestehen, dass wir es zu Hause nicht mehr hinkriegen.
Haben Sie sich je gewünscht, dass Ihr Mann früher stirbt?
Ich habe mir ganz oft gewünscht, dass mein Mann stirbt. Alles andere wäre verlogen. Ich hätte meinem Mann gerne vieles erspart und abgenommen, auch wenn ich eine große, große Traurigkeit empfinde, weil er so viel Leben verpasst hat. Er wäre so gerne dabei gewesen, wenn sein Sohn jetzt Abi macht oder seine Tochter konfirmiert wird. Aber ich glaube, dass es wahnsinnig egoistisch wäre, sich zu wünschen, dass jemand, der nicht mehr weiß, was das Braune in der Tasse ist, noch zehn Jahre lebt. Mein Mann hat die Krankheit mit ganz viel Würde, Anstand und Standfestigkeit ertragen. Dennoch habe ich immer wieder gesehen, wie sehr ihn das Leben angestrengt hat. Ich hätte nicht eine Woche mit ihm tauschen wollen. Darum gab es immer wieder Momente, in denen ich gedacht habe: Könnte ich Dir die Anstrengungen abnehmen, ich würde es sofort tun.
Sie machen sich in Ihrem Buch über die Art, wie andere Menschen konventionell trauern, lustig. Über Erbseneintöpfe, die Ihnen Nachbarn nach dem Tod Ihres Mannes ungefragt, aber sicher gutgemeint vor die Tür gestellt haben, schreiben Sie, dass Sie sie im Klo runtergespült haben, weil Sie irgendwann keine Mitleids-Eintöpfe mehr essen konnten. Das kann Menschen verletzen. War das nötig?
Wahrscheinlich hat eine Mischung aus Wut und Hochmut zu dieser bewusst verletzenden Reaktion geführt. Ich weiß, dass ich mich damit angreifbar gemacht habe, aber ich habe so versucht, der Ohnmacht Herr zu werden und mir ein Stück Selbstwirksamkeit zurückzuholen. Nach dem Motto: Diese Hilfe nehme ich an – und diese nicht.
Können Sie sich vorstellen, sich erneut zu verlieben?
Ich kann mir gut vorstellen, dass der Zeitpunkt dafür eines Tages kommen wird. Aber im Moment finde ich es gut, wie wir uns eingerichtet haben. Ich will die Kinder jetzt erst mal gut auf die Spur bringen. Aber voraussichtlich in vier Jahren wird meine Tochter das Haus verlassen, ihre beiden älteren Brüder werden schon vorher ausziehen. Dann wird sich sicher etwas anderes entwickeln.
Haben Sie sich je gefragt: Warum ausgerechnet ich?
Nein! Denn dann müsste ich mich ja auch fragen: Wie kommt mir dieses ungeheure Glück zuteil, drei gesunde Kinder zu haben und in einem Land zu wohnen, in dem kein Krieg herrscht? Ich bin nie vergewaltigt oder ausgeraubt worden. Warum eigentlich nicht? Ich habe nicht in Tschernobyl gelebt, als es zum GAU kam. Wieso habe ich dieses unverschämte Glück, dass ich gesund und in der Lage bin, Geld zu verdienen? Die Frage »Warum ich?« ist ein reiner Hirnfick! Das bringt nichts.
Hatte die Krankheit irgendetwas Gutes?
Oh ja. Meine Kinder und ich haben seitdem einen sensationellen Zusammenhalt. Wir haben alle eine sehr feinstoffliche Menschenkenntnis entwickelt, die ich meinen Kindern niemals auf rein theoretischer Ebene hätte beibringen können. Die Krankheit hat meine Kinder ganz große Sozialkompetenz, Barmherzigkeit und Pragmatismus gelehrt. Wir haben den Reichtum des Lebens im Guten wie im Schlechten kennengelernt. Würden wir das alles sofort eintauschen, um meinen Mann noch mal eine Woche gesund bei uns zu haben? Sofort!
In Deutschland leben nach Angaben der Deutschen Alzheimer Gesellschaft e. V. rund 1,8 Millionen Menschen mit Demenz. Die meisten von ihnen sind von der Alzheimer-Krankheit betroffen. Sie führt zum Absterben von Zellen des zentralen Nervensystems und ist nach dem deutschen Psychiater und Neuropathologen Alois Alzheimer benannt, der das Krankheitsbild erstmals 1906 beschrieb. Allein in Deutschland treten jeden Tag etwa 900 Neuerkrankungen auf. Pro Jahr sind das jedes Jahr fast 440 000 weitere Alzheimer-Patient*innen. Aufgrund der gestiegenen Lebenserwartung wird die Zahl der Alzheimer-Patienten in Zukunft stark steigen.
Zwei Drittel der Erkrankten haben bereits das 80. Lebensjahr vollendet. Nur rund 0,1 Prozent der Betroffenen sind zwischen 45 und 64 Jahre alt. Mit Medikamenten und geistiger Anregung kann das Fortschreiten der Krankheit verzögert werden, bislang ist eine Heilung jedoch nicht möglich. Neben dem Abbau der kognitiven Fähigkeiten führt Alzheimer auch zum Muskelabbau. Nachdem die Diagnose gestellt worden ist, beträgt die verbleibende Lebenserwartung in den meisten Fällen sieben bis zehn Jahre.
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.