- Politik
- Mietenwahnsinn
Andrej Holm: »Das Wohnen muss demokratisiert werden«
Stadtsoziologe Andrej Holm über Strategien im Kampf gegen explodierende Mieten
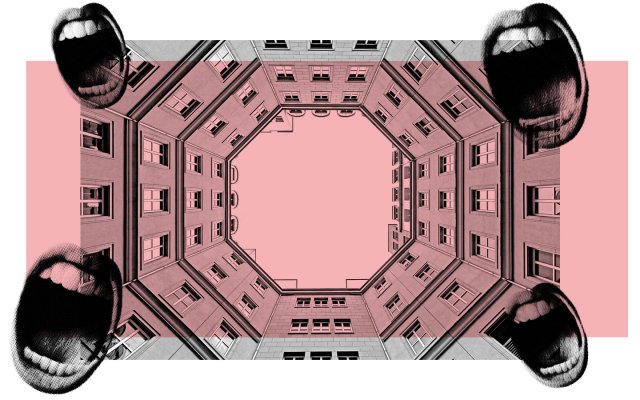
Mieten und Immobilienpreise steigen global. Eigentlich sollte der Zuzug in bestimmte Städte die Preise an weniger beliebten Orten fallen lassen. Aber das geschieht kaum. Wohnen wird überall teurer. Warum?
Das hat vor allem zwei Gründe. Einerseits sind die Mietsteigerungen Ausdruck einer veränderten ökonomischen Logik. Im Rahmen der sogenannten Finanzialisierung sind Wohnanlagen und Grundstücke verstärkt in international gehandelte Anlageobjekte verwandelt worden. Dadurch sind die Ertragserwartungen stark gestiegen. Miet- und Kaufpreise orientieren sich also nicht mehr an der Substanz einer Wohnung oder eines Gebäudes, sondern an finanzwirtschaftlichen Strategien. Allgemein kann man wohl sagen, dass extrem viel Geld unterwegs ist, das die Immobilienmärkte flutet und einen Rückfluss erwartet.
Andererseits gehen die steigenden Mieten auf die Privatisierungs- und Deregulierungspolitik der vergangenen Jahrzehnte zurück. Vor allem in den europäischen Ländern wurden Millionen von vormals öffentlichen Wohnungen privatisiert. Das betrifft das council housing in England, große öffentliche Wohnungsbestände in den skandinavischen Ländern und Frankreich sowie viele öffentliche Wohnungsunternehmen in der Bundesrepublik. In vielen Ländern wurde zudem das Mietrecht liberalisiert, so dass Mietsteigerungen einfacher durchzusetzen sind. Private Vermieter und kommerzielle Wohnungsunternehmen haben heute fast überall ein Quasimonopol und können die Mietpreise nach ihren Interessen gestalten.
Andrej Holm, 1970 in Leipzig geboren, ist Sozialwissenschaftler. Er forscht an der HU Berlin zu den Themen Mieten, Stadtentwicklung und Gentrifizierung. 2023 gab Holm gemeinsam mit Georgia Alexandri und Mathias Bernt die englischsprachige Studie »Wohnungspolitik unter Bedingungen der Finanzialisierung« heraus, in der die Lage in mehreren europäischen Großstädten verglichen wird.
Kann man sagen, dass die Entwicklung auf den Wohnungsmärkten derselben Logik folgt wie die Spekulation mit Papieren und Rohstoffen auf den Börsen?
Ja, sie ist Ausdruck eines globalen Trends: Die Gewinnstrategien koppeln sich immer stärker von tatsächlichen Produktionsbedingungen ab und werden fiktiv. An den Börsen werden heute Ableitungen von Ableitungen gehandelt. Die Derivate auf Immobilienpapiere haben mit der realen Substanz von Gebäuden kaum noch etwas zu tun.
Sie schreiben in einer aktuellen Studie, Berlin sei die europäische Stadt mit den höchsten Umsätzen bei Mietimmobilien: 42 Milliarden Euro wurden 2021 dort umgesetzt – in London waren es 27,7 Milliarden. Danach folgten Amsterdam, Paris und Wien. Warum ist Berlin so lukrativ?
Die Statistik bezieht sich auf Paketverkäufe, also auf den Handel mit einer bestimmten Menge von Immobilien. Wenn man den Verkauf von einzelnen Häusern und Wohnungen mit einbeziehen würde, wäre der Markt in London sicherlich größer. Doch Berlin war in den letzten Jahren Spitzenreiter, wenn es darum ging, größere Wohnungsbestände als Anlageprodukt zu handeln. Das hat mit der Privatisierungsgeschichte in Berlin, aber auch mit der Struktur als Mieterstadt zu tun. Seit der Privatisierung öffentlicher Wohnungen werden einfach immer wieder große Bestände verkauft. Für eine finanzialisierte Anlagestrategie ist es natürlich attraktiv, wenn man nicht Dutzende Einzelhäuser kaufen muss, sondern gleich ein Paket mit Tausenden von Wohnungen erwerben kann.
Das andere europäische Land, in dem diese Entwicklung gerade stattfindet, ist Schweden. Welche Parallelen gibt es da?
Eine hohe Mieterquote und eine ausgeprägte Wohlfahrtspolitik in der Vergangenheit. In Schweden entstand unter den sozialdemokratischen Regierungen ein großer kommunaler und genossenschaftlicher Sektor. Der Kern der neoliberalen Wohnungspolitik war auch in Schweden der Verkauf großer Bestände. Heimstaden und Vonovia sind in Schweden deshalb genauso aktiv, wie wir das aus einigen deutschen Städten kennen.
Im Prinzip ist das eine Form von »Landnahme«, wie es Klaus Dörre genannt hat: eine Privatisierung des Öffentlichen?
Ja, es ist eine Enteignung des Öffentlichen. Eine neue Welle ursprünglicher Akkumulation, wenn man so will. Und dieser Prozess ist in solchen Wohnungsmärkten besonders ausgeprägt, die zuvor stark von öffentlicher Regulation und staatlichem Handeln geprägt waren. Deshalb kann man die Finanzialisierung auch nicht ohne den Rückzug der Wohlfahrtspolitik verstehen. Der neoliberale Politikwechsel schafft die Voraussetzungen der Finanzialisierung.
Der größte Player in Deutschland ist Vonovia, wenn ich das richtig verstanden habe. Was ist das für ein Unternehmen und warum spielt es eine so zentrale Rolle?
Vonovia hat europaweit etwa 550 000 Wohnungen und ist der mit Abstand größte finanzialisierte Akteur auf dem Bereich der Wohnimmobilien. Seinen Ursprung hat das börsennotierte Unternehmen in der Deutschen Annington, die in Westdeutschland vor allem Eisenbahnerwohnungen aufgekauft hatte. Vonovia hat früher als andere institutionelle Investoren von einer Strategie der schellen Weiterverkäufe auf eine langfristige Bewirtschaftung der Immobilien umgestellt. In der Forschung wird dieser Wechsel als Finanzialisierung 2.0 bezeichnet. Basis des Geschäftsmodells war in den vergangenen Jahren eine Expansionsstrategie, die darauf setzte, den Unternehmenswert kontinuierlich zu steigern. Die größte Übernahme war die der Deutsche Wohnen 2021.

Mit unserem wöchentlichen Newsletter nd.DieWoche schauen Sie auf die wichtigsten Themen der Woche und lesen die Highlights unserer Samstagsausgabe bereits am Freitag. Hier das kostenlose Abo holen.
Trotzdem machen diese Großinvestoren gegenüber den Privatvermietern in Deutschland nur einen kleinen Teil aus.
Bundesweit liegen nur etwas mehr als 2 Prozent des Mietwohnungsbestands bei finanzialisierten Vermietern, aber in Berlin sind es fast 20 Prozent. Großbestände zu kaufen und zu bewirtschaften ist aus Sicht dieser Unternehmen natürlich viel effizienter. Deswegen konzentrieren sich Firmen wie Vonovia auf große Städte, in denen es zuvor einen großen öffentlichen oder gemeinnützigen Wohnungsbestand gab. Auch in Schweden ist das in Städten wie Malmö eher der Fall als auf dem platten Land.
In Berlin werden 1,1 Millionen Mietwohnungen, also 70 Prozent des Gesamtbestands, von Privatvermietern gehalten. 340 000 Wohnungen gehören städtischen Anbietern, 190 000 sind genossenschaftlich. Und 85 Prozent sind Mietwohnungen. Wie sieht das eigentlich in den ehemals sozialistischen Ländern Osteuropas aus? Wie hoch ist da die Eigentums- bzw. Mietquote?
In ehemals sozialistischen Ländern sind die Mietquoten im Allgemeinen sehr gering, weil sich die Privatisierung in fast allen Ländern – Polen, Ungarn, Bulgarien, Rumänien … – am britischen Modell orientierte. Dort gab es das »right to buy«, also das Recht, die eigene Mietwohnung als Eigentümer zu erwerben. Ich würde das als flächendeckende Mikroprivatisierung bezeichnen. Aus diesem Grund ist die Eigentümerquote in den ehemals sozialistischen Ländern im europäischen Vergleich viel höher als im Rest Europas. Die höchste Quote hat meines Wissens Rumänien mit einer offiziellen Eigentumsquote von fast 95 Prozent. Dort wurde die Privatisierung ehemals staatlicher Wohnungen besonders entschlossen vorangetrieben.
Und inwiefern wird man durch fehlendes Immobilieneigentum heute zum Angehörigen der »unteren Klasse«? Man hat ja den Eindruck, dass viele Leute trotz hohen Einkommens ökonomisch unter Druck geraten, während Immobilieneigentümer trotz prekärer Jobs ganz gut über die Runden kommen. Müsste der Immobilienbesitz nicht eine zentralere Stellung bei der Analyse von Klassen und Ungleichheit einnehmen?
Es gibt in den letzten Jahren unter dem Stichwort »Rentenkapitalismus« (rentier capitalism) einige Forschungsbeiträge, die versuchen, die Verfügungsgewalt über Immobilien und die daraus erzielten Erträge systematischer in eine Klassenanalyse einzubeziehen. Die Stellung in der Gesellschaft wird demnach nicht nur durch die Position im Arbeitsprozess und das Einkommen bestimmt, sondern auch durch den Besitz oder Nicht-Besitz von Immobilien. So richtig durchsetzen konnte sich dieser Ansatz bisher nicht, weil die meisten Wissenschaftler*innen, die sich mit dem Klassenbegriff beschäftigen, eine marxistische Grundbildung haben und sich nur schwer von der Idee einer arbeitszentrierten Klassenzugehörigkeit trennen können. Dabei können wir klar sehen, dass die soziale Stellung zunehmend von Wohnsituationen und Eigentumsfragen überformt ist. Zudem ist Immobilienbesitz ja auch eine Einkommensstrategie. Wer nicht nur die eigene Wohnung, sondern noch eine zweite oder dritte besitzt, profitiert von einem beständigen Einkommenstransfer. Die Einkommen der einen fließen als Mietzahlungen auf die Konten der anderen. Das läuft natürlich auf eine stete Umverteilung innerhalb der Gesellschaft hinaus. In Deutschland wohnt fast die Hälfte der Haushalte zur Miete, und die Summe aller Mietzahlungen beträgt etwa 140 Milliarden Euro. Ein Großteil davon geht an andere private Haushalte und Unternehmen. Je höher die Mietpreise, desto größer der Ungleichheitseffekt.
Was für eine Strategie halten Sie im Kampf gegen die Mietenexplosion eigentlich für erfolgversprechend? Brauchen wir eine politische Einhegung des Marktes? Mehr öffentlichen Wohnungsbau? Eine Stärkung selbstverwalteter Genossenschaften?
Für eine gute Wohnungspolitik gibt es keinen Königsweg. Was jedoch nicht fehlen darf, ist eine klare Orientierung auf die Transformation des Wohnungswesens. In der kritischen Wohnforschung wird die Strategie für eine solche Veränderung mit den Begriffen »De-Kommodifizierung und Demokratisierung« beschrieben. De-Kommodifizierung bedeutet, dass das Wohnen vom Markt genommen, die Verwertungsmechanismen außer Kraft gesetzt werden müssen. Demokratisierung meint in erster Linie, dass wir die Mitsprache der Bewohner*innen stärken müssen. Im wohnungspolitischen Getümmel, wo immer neue Einzelinstrumente ins Gespräch gebracht werden, kann man anhand dieser beiden Kriterien beurteilen, wie transformativ sich ein bestimmtes Instrument am Ende auswirkt. In den letzten vier Jahrzehnten haben wir gesehen, dass die Regulierung über Gesetze, Verbote und Verordnungen nicht gut funktioniert, weil es nicht genug Personal gibt, um die Umsetzung zu kontrollieren. Die strengste Zweckentfremdungsverordnung ist wirkungslos, wenn das Bezirksamt zu klein ist, um für die Einhaltung zu sorgen. Bei der Mietpreisbremse haben wir etwas Ähnliches erlebt: Die Sozialdemokratie hat sie bejubelt, aber in der Praxis läuft die Bremse ins Leere, weil sich viele Vermieter*innen einfach nicht daran halten. Auch die staatliche Mittelvergabe scheint mir als Mittel nicht besonders effizient. Die Förderprogramme sind in Deutschland ja immer zeitlich begrenzt. Dadurch bleibt auch der soziale Wohnungsbau befristet. Greifen könnte eine andere Politik nur, wenn sie dauerhaft etabliert würde – was aber nicht geschieht, weil immer wieder neue Prioritäten gesetzt werden, also jetzt beispielsweise Waffen wichtiger sind als Wohnungen.
Was als Instrument hingegen auch langfristig wirken würde, wäre die Stärkung von öffentlichem und Gemeineigentum. Das wäre – neben der Regulation und der Vergabe von Finanzmitteln – der dritte Modus staatlichen Handelns. So wie die Kommunen Schulen und Bibliotheken unterhalten, müssten sie auch Wohnraum zur Verfügung stellen. Das wäre der entscheidende Ansatz. Und was Ihre Frage nach den selbstverwaltete Genossenschaften angeht: Das sind interessante Experimente, aber viel zu voraussetzungsreich für das Gros der Bevölkerung.
Sie betonen auf Veranstaltungen gern, dass sich »kämpfen lohnt«. Wie könnte die Mieterbewegung wieder in die Vorderhand kommen?
In Berlin gab es im letzten Jahrzehnte ausgeprägte Mieterkämpfe. Viele kleine Gruppen haben praktische Forderungen gestellt. Vorkaufsrecht, Milieuschutz, Umwandlungsverordnung – fast alles, was unter Rot-rot-grün an progressiver Wohnungspolitik gemacht wurde, kam als Forderung ursprünglich aus der Mieterbewegung. Aber offensichtlich hat dieser Ansatz nicht zum gewünschten Erfolg geführt. Die Mieten steigen weiter, die Zahl der Wohnungslosen wächst. Deshalb ist ein Strategiewechsel nötig. Die Kampagne »Deutsche Wohnen Enteignen & Co« hat das versucht. Sie will den öffentlichen Wohnungsbestand über Enteignungen erweitern. Die Kampagne hat das Volksbegehren klar gewonnen, die Umsetzung wird aber vom Senat verweigert. Nun versuchen Initiativen über Organizing-Ansätze eine klassisch-gewerkschaftliche Perspektive stark zu machen. Ob dieser Ansatz helfen kann, die Durchsetzbarkeit eines radikalen Reformprogramms, wie es die Vergesellschaftung wäre, zu stärken, wird sich erst in den nächsten Jahren zeigen.
Wir stehen zum Verkauf. Aber nur an unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört denen, die sie lesen und schreiben. Sie sichern mit ihrem Beitrag, dass unser Journalismus für alle zugänglich bleibt – ganz ohne Medienkonzern, Milliardär oder Paywall.
Dank Ihrer Unterstützung können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen in den Fokus rücken
→ marginalisierten Stimmen eine Plattform geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und weiterentwickeln
Mit »Freiwillig zahlen« oder einem Genossenschaftsanteil machen Sie den Unterschied. Sie helfen, diese Zeitung am Leben zu halten. Damit nd.bleibt.







