- Kommentare
- Sachsen und Thüringen
Wenn Nazis jubeln
Die Landtagwahlen in Sachsen und Thüringen zeichnen ein düsteres Bild der kommenden politischen Entwicklung in Deutschland

Vielleicht besitzt Benjamin-Immanuel Hoff seherische Fähigkeiten. In einem langen Analysetext zu Zustand und Aussichten der Linken, verbreitet am Tag vor den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen, schrieb der Linke-Politiker, es werde für seine Partei »schlechter werden, bevor es möglicherweise besser wird«. Diese Vermutung ist berechtigt, wenn man sich ansieht, wie schnell die Hoffnungen in der Linken verpufft sind, dass es nach der Wagenknecht-Abspaltung wieder bergauf gehe.
Die Wahlergebnisse dieses Sonntags in Sachsen und Thüringen bestätigen den Eindruck einer anhaltenden Krise. In beiden Ländern hat sich Die Linke etwa halbiert; in Thüringen immerhin von einem Allzeit-Hoch 2019, in Sachsen von einem damals schon schlechten Ergebnis.
Die Misere der Linken ist aber nur Teil eines größeren Dramas; der Begriff klingt pathetisch, doch die Lage ist danach. Wenn eine Partei wie die AfD, die sich kaum noch Mühe gibt, die bürgerliche Fassade zu bewahren, derart stark gewählt wird – deutliche Gewinne gegenüber den letzten Landtagswahlen, kaum Verluste nach den großen Protesten Anfang des Jahres –, dann ist Alarmstimmung angesagt. Diese AfD wird sich nicht normalisieren, das hat ihre bisherige Entwicklung gezeigt. Sie demonstriert teils offenen Rechtsextremismus und hat keinerlei Hemmungen vor Anklängen an die NS-Ideologie. Wie es aussieht, kann sie in den Landtagen von Sachsen und Thüringen eine Sperrminorität erreichen, das heißt: mehr als ein Drittel der Mandate, mit denen sie wichtige Entscheidungen verhindern und so die anderen Parteien vor sich her treiben kann. Das ist der demokratische worst case.
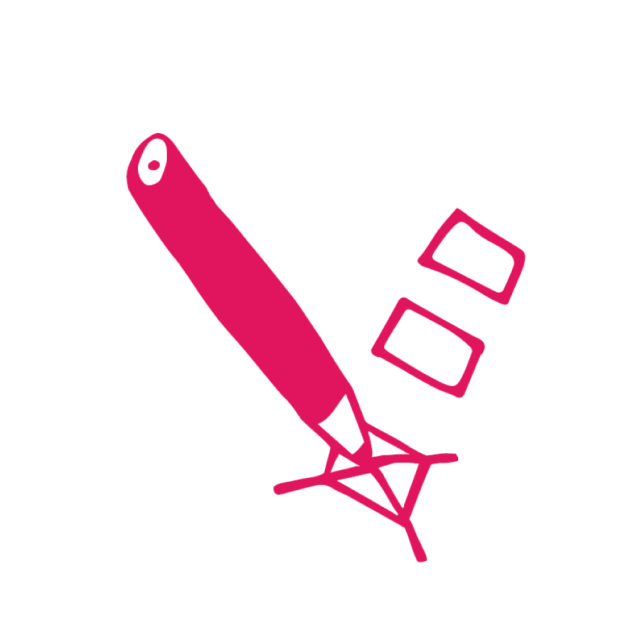
Das Wahljahr 2024 ist kein beliebiges. Schon lange nicht mehr war die Zukunft der Linken so ungewiss, noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik waren die politische Landschaft und die Wählerschaft so polarisiert, noch nie seit der NS-Zeit war eine rechtsextreme, in Teilen faschistische Partei so nah an der Macht. Wir schauen speziell auf Entwicklungen und Entscheidungen im Osten, die für ganz Deutschland von Bedeutung sind. Alle Texte unter dasnd.de/wahljahrost.
Nun wird sich in verschärfter Form die Frage nach dem Umgang mit der AfD stellen. Die viel diskutierte Brandmauer sieht aus wie die Berliner Mauer im Spätherbst 1989: zerlöchert und durchlässig. Immer öfter gibt es politische Zusammenarbeit mit den Rechtsextremen. Es geht nicht darum, ob man irgendwo gemeinsam die Aufstellung einer neuen Straßenlaterne beschließt. Es geht darum, sich unablässig – und Anlässe gibt es dafür leider beinahe täglich – mit der inhumanen Ideologie dieser AfD, mit ihrem hinter volkstümelnden Parolen versteckten Neoliberalismus, mit ihrem Nationalismus und Rassismus auseinanderzusetzen und ihr nichts davon durchgehen zu lassen.
Das wird allerdings umso schwerer, da andere Parteien um ihre Existenz kämpfen. Nicht alle wie Die Linke derzeit generell, aber zumindest in bestimmten Regionen. In Sachsen und Thüringen wurde die FDP jetzt ins Nichts hinweggefegt, die Grünen pendeln um die fünf Prozent, die SPD hat sich auf anhaltend schwachem Niveau wieder in die Parlamente gerettet. Die Ampel – das angebliche Fortschrittsmodell der Bundesregierung – ist in diesen beiden Bundesländern faktisch erloschen. Auf Bundesebene wird sie ja von manchen Beteiligten schon infrage gestellt.
Die Ampel-Pleite hat maßgeblich mit deren eigener Politik, aber auch mit der Kampagne des BSW zu tun. Denn Sahra Wagenknecht hat die beiden Landtagswahlen – und ebenso die folgende in Brandenburg – zu Abstimmungen gegen die Ampel-Politik ausgerufen. Man geht wohl nicht fehl, wenn man dahinter auch den gewieften Taktiker Oskar Lafontaine vermutet, der hier seinen fünften oder sechsten Frühling auslebt. Die Anti-Ampel-Kampagne passt zu Wagenknechts sonstiger Schwarz-Weiß-Malerei ohne Rücksicht auf Zwischentöne und Differenzierungen. Sie schöpft den gerade im Osten verbreiteten Unmut über Krieg und Krise ab, erzählt alles, was die Leute hören wollen, und strickt daraus eine Art Programm.
Natürlich findet sie dafür Anhänger, aber denen traut sie offenbar nicht über den Weg. Sie behandelt ihre Leute in den Ländern wie Unmündige, und die lassen sich das im Gefühl des Erfolgs gern gefallen. Wie ist es sonst zu erklären, dass Wagenknecht und ihre engsten Vertrauten alles, von der Aufnahme von Mitgliedern in ihre Partei bis zu möglichen Koalitionsverhandlungen in den Ländern, selbst in der Hand behalten wollen? Und wie ist es zu erklären, dass Wagenknecht gerade erst in einem Interview auf die Frage, warum sie überall auf den Wahlplakaten zu sehen ist, obwohl sie gar nicht kandidiert, erklärte: Natürlich kandidiere sie mit ihrem Programm.
Das ist ein einigermaßen verqueres Politikverständnis. Aber lange wird das Label Wagenknecht nicht mehr verhindern können, dass sichtbar wird, wie viel (oder wie wenig) inhaltliche und personelle Substanz in dieser flugs zusammengenagelten, von den Medien auf Händen getragenen Partei existiert. Man darf da berechtigte Fragezeichen setzen. Ob in einer Regierung oder in der Opposition – der politische Alltag beginnt demnächst wieder, und viele werden nach dem monatelangen Wagenknecht-Hype genau hinsehen. Auch darauf, wie lange das BSW geradezu monolithisch der Erfüllungsgehilfe der Ideen aus dem Hause Wagenknecht/Lafontaine bleibt. Und wie kreativ die BSW-Leute ihre zuletzt, sagen wir mal, geschmeidige Haltung zur AfD weiterentwickeln. Mit dem behaupteten Ziel, die AfD zu schwächen, sind sie jedenfalls komplett gescheitert.
Gut möglich, dass die Verwerfungen, die wir jetzt im ostdeutschen Parteiensystem erleben, Vorboten einer gesamtdeutschen Entwicklung sind. Dass Kräfte weiter gewinnen, die mit Ressentiments, Vorurteilen und nationalem Egoismus auf Besitzstandsängsten aufbauen. Das gelingt ihnen auch, weil etablierte Parteien vor den Herausforderungen der heutigen Welt, vor den sich zuspitzenden Widersprüchen versagen. Wenn Politik die Mentalität »Jeder ist sich selbst der Nächste« befördert, dann blicken wir in eine düstere Zukunft.
Vielleicht gilt der Satz von Benjamin-Immanuel Hoff, es werde schlechter, bevor es möglicherweise besser wird, nicht nur für Die Linke, sondern für die gesamte politische Situation. Und wahrscheinlich ist er nicht hellseherisch, sondern einfach nur realistisch. Wenn Nazis jubeln, kann es nur schlecht aussehen.
Es wäre jetzt wirklich höchste Zeit, dass sich die Parteien jenseits der AfD ungeachtet aller Differenzen auf etwas einigen und an etwas halten, was man einen demokratischen Grundkonsens nennen könnte: Festhalten an einer ungeteilten Humanität, egal, woher ein Mensch kommt; verteidigen der demokratischen Gesellschaft gegen alle Angriffe auf den Straßen, in Ämtern und Parlamenten; kein Kokettieren oder gar Paktieren mit rechts außen; kein Nachplappern oder Vorempfinden ihrer menschenfeindlichen Parolen.
Das sollte selbstverständlich sein: nicht zuerst auf den eigenen parteitaktischen Vorteil zu schauen, sondern auf den Zusammenhalt der Gesellschaft. Es ist eigentlich nicht viel, aber es ist ungeheuer wichtig. Oder ist das nur noch haltloses Wunschdenken? Gelingt das nicht, dann ist jedenfalls das Sprechen von den demokratischen Parteien nur Gerede.
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.







