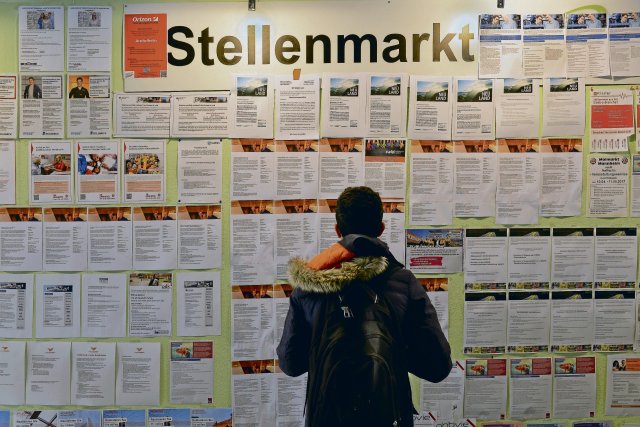Die Geschichte der DDR und die rot-rote Zukunft
Brandenburgs Ministerpräsident besuchte Stasi-Gedenkstätte
Es stinkt den Ministerpräsidenten Matthias Platzeck (SPD) an. Er hatte gehofft, dass 20 Jahre nach der Wende über die enorme Aufbauleistung der Ostdeutschen geredet wird. Stattdessen immer wieder die Frage: »Warst Du in der SED?«
»Waren Sie in der Partei?«, fragt am Mittwoch nun auch Hubertus Knabe, Leiter der Gedenkstätte im ehemaligen MfS-Untersuchungsgefängnis in Berlin-Hohenschönhausen. »Nein«, antwortet der in Potsdam in bürgerlichen Verhältnissen aufgewachsene Ministerpräsident. Er bekennt jedoch, dass er als junger Mann den Sozialismus toll fand. Zum Umdenken habe ihn die Ausbürgerung des Liedermachers Wolf Biermann bewogen.
Platzeck schaut sich die Gedenkstätte an. Dieter Drewitz führt ihn herum. Drewitz wurde 1966 im Alter von 23 Jahren festgenommen und anderthalb Jahre eingesperrt, weil er zwei Briefe an den Westberliner Radiosender RIAS schrieb, in denen er sich zur deutschen Einheit äußerte. Nur die Wand angestarrt habe er, keine Farben mehr gesehen, erinnert sich Drewitz in einer Zelle. »Die Sinnesorgane waren arbeitslos.« Drewitz führte vor Platzeck auch 29 Schüler der Ehm-Welk-Oberschule Angermünde – und mit denen spricht der Ministerpräsident anschließend. Dies war sein Wunsch. Im Klassenraum hätte er die Jugendlichen nicht mehr aufsuchen dürfen, denn es gilt die Regel, dass sich Politiker wenige Wochen vor der Wahl in den Schulen nicht mehr blicken lassen sollen.
Platzeck fragt die Jugendlichen nach ihrem Eindruck. Er möchte wissen, wie es dazu passt, was ihnen Eltern und Großeltern über die DDR erzählt haben. Die haben gut geredet über die DDR und gemeint, so streng sei es da nicht gewesen, wie heute erzählt werde, heißt es.
»Ich habe Verständnis, wenn manches der Verklärung anheim fällt«, beteuert Platzeck. »Wir leben auch heute nicht in einer idealen Gesellschaft«, räumt der Politiker ein und gibt zu, er könne nicht allen Schulabgängern einen Ausbildungsplatz garantieren. Doch man müsse realistisch sein. »Hunderttausende, die 1989 das Land verließen oder auf die Straße gingen, haben damit ein Urteil über die DDR abgegeben.«
Platzeck fragt, ob genug Zeit sei im Lehrplan für die DDR. Im Hinterkopf hat er, das Thema sei in der 10. Klasse kurz vor den Ferien dran und falle oft hinten runter. Jetzt sind die Schüler beim Zweiten Weltkrieg und der sei auch wichtig, betont Geschichtslehrerin Astrid Maschke. Für die DDR werde bei ihr genug Zeit bleiben. Sie möchte kein Schwarz-Weiß-Bild vermitteln. Die DDR sei vielfältig gewesen. Es habe nicht nur Täter und Opfer gegeben.
Man müsse Menschen auch danach beurteilen, wie sie sich nach 1989 verhalten haben, hat Platzeck indes mit Blick auf Kerstin Kaiser erklärt. Wenn es zu Koalitionsverhandlungen mit der LINKEN kommt, muss er diesen Satz wahrscheinlich noch oft wiederholen.
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.