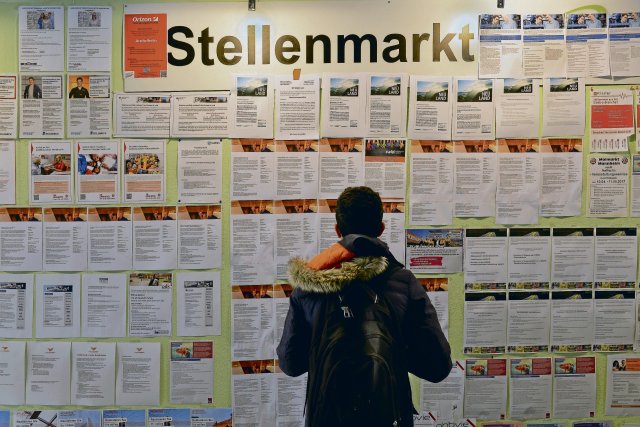Blick zurück ohne Zorn
Dank eines Dresdner Vereins hat sich der einstige Zwangsarbeiter Jakow Nepotschatow mit dem Land seiner Peiniger ausgesöhnt

Nach 66 Jahren steht Jakow Nepotschatow wieder im Stollen. Die Eisentür fällt schwer ins Schloss und sperrt das Tageslicht aus. Nur einige Lampen in Hüfthöhe werfen ihr fahles Licht auf den Betonboden. Der alte Mann geht, auf seinen Stock gestützt, tiefer in den Gang hinein, der nach hundert Metern auf den Hauptstollen trifft. Die Luft ist kühl und feucht. Die Häftlinge, die in dieser unterirdischen Fabrik V2-Raketen und Triebwerke montieren mussten, hätten in Nischen im Fels gehaust, erklärt der junge Besucherführer der KZ-Gedenkstätte Dora-Mittelbau. »Ich weiß«, sagt Nepotschatow auf Russisch, »ich habe die Holzbetten gebaut.«
Von der Straße weg zur Zwangsarbeit
Als Jakow Nepotschatow das erste Mal an den Kohnstein kam, in dessen Flanken die viele Kilometer langen Stollen getrieben sind, war er 17 Jahre alt. Zwei Jahre zuvor war er in Charkow auf der Straße arretiert und nach Deutschland zur Zwangsarbeit geschickt worden. Aus einer Tischlerei in Halle lief er fort, was ihm eine Verurteilung wegen Sabotage und die Einlieferung ins KZ Buchenwald eintrug. Dort nagelte er Holzpantinen für die Häftlinge zusammen – zu sorgfältig, wie ein SS-Mann meinte. Weil er Nägel verschwendet habe, wurde er einem Kommando zugeteilt, das am Kohnstein ein neues KZ-Außenlager errichten sollte. Das Datum, an dem er in der Hölle ankam, weiß er noch genau: »Es war der 2. September 1943.«
Rund um den Kohnstein, einen Karstfelsen nicht weit von Nordhausen, erstreckten sich damals Felder, »Kartoffelfelder, die schon abgeerntet waren«, sagt Nepotschatow. Eine Baskenmütze gegen den kalten Novemberwind auf dem Kopf, steht der jetzt 83-Jährige neben einem Plan des Lagers und sucht Baracke Nummer 11, in der die Tischlerei untergebracht war. Dort arbeitete der Häftling mit der Nummer 4850, Kategorie »Russe / politisch«, nach den fürchterlichen ersten sechs Monaten. Die hatte er ausschließlich im Berg verbracht. Die Häftlinge bauten dort eine Anlage auf, die später zur größten unterirdischen Rüstungsfabrik werden sollte. Viele starben – an Auszehrung, an Seuchen, wegen der permanenten Nässe. Die Toten, sagt der Besucherführer, wurden »ersetzt wie Werkzeuge, die nicht mehr zu brauchen waren«. Von 60 000 Häftlingen, die nach Dora-Mittelbau gebracht wurden, überlebten 20 000 nicht.
Nepotschatow ist dem Lager, in dem Menschen verschlissen wurden, auf dass die »Wunderwaffe« den Totalen Krieg doch noch gewinnen helfen sollte, entronnen. Dank eines umsichtigen Mithäftlings, der ihm eine dunkle Brille gab, erblindete er nicht, als er nach einem halben Jahr erstmals aus den Stollen ans Tageslicht zurückkehrte. Er überstand die unmenschlich harte Arbeit und im Frühjahr 1945 auch den Todesmarsch nach Bergen-Belsen. Als er, auf unter 40 Kilogramm abgemagert, befreit worden war, lief er zurück nach Hause, wo er indes umgehend ins Bergwerk geschickt wurde – wie es hieß, zur »Bewährung«. Schließlich galten jene, die die deutsche Haft überlebt hatten, als Verräter. In dieser Zeit starb seine Mutter, die seit 1941 nichts von ihm gehört hatte; Nepotschatows Vater und Bruder waren zuvor an der Front gefallen. Dass er kein verbitterter Mensch wurde, nötigt Respekt ab. Ein Entschluss stand allerdings unumstößlich fest: Nach Deutschland würde er nie zurückkehren. »Ich hatte damit abgeschlossen«, sagt er: »Wo die SS war, wollte ich nie mehr sein.«
Fürsorge für russische Kriegsveteranen
-
/ Moritz AschemeyerNS-Zwangsarbeit: Ausgebeutet und vergessenGedenkspaziergang erinnert an KZ-Zwangsarbeit bei Daimler-Benz in Ludwigsfelde
-
/ Hendrik LaschDas Grauen vor der eigenen HaustürStele erinnert in Leipzig an Ex-Zwangsarbeiterlager – vor einer Immobilie, die heute einem Rechtsextremen gehört
-
/ Felix KlopotekMarxismus der ZwangsarbeiterDer Kommunist Heinz Langerhans wurde von den Nazis verfolgt und gefoltert. Später verfasste er eine Totalitarismustheorie, seine Schriften sind jedoch weitgehend unbekannt und unveröffentlicht
Die beeindruckende Arbeit wurde vielfach gewürdigt. Erst Ende Oktober erhielt der Verein einen 1. Preis für »Partnerschaft und Bürgerengagement in der west-östlichen Zusammenarbeit« vom Internationalen Club im Auswärtigen Amt. Ausgezeichnet wurden ein »außergewöhnliches Engagement« bei der Verbesserung der Lebensbedingungen von Kriegsveteranen und NS-Opfern sowie für »dauerhafte Versöhnung zwischen Deutschen und Russen«.
Es war denn auch Danders, die eines Tages mit einer Rose in der Hand bei Nepotschatow in dessen Heimatstadt Puschtschino vor der Tür stand und ihm von der Arbeit des Vereins berichtete, dessen oberstes Anliegen die Versöhnung zwischen den einstigen Feinden ist. Nepotschatow, der es zum Direktor eines Holzbetriebes gebracht hatte, bevor er in Rente ging, hörte aufmerksam zu. Die Einladung nach Deutschland freilich schlug er aus – beim ersten und bei vielen folgenden Malen. Erst 2001, als der 60. Jahrestag des Kriegsbeginns begangen wurde, machte er sich auf den Weg – und besuchte sogar Buchenwald. Er habe, heißt es, vor dem Tor lange gezögert, bevor er sich dazu durchringen konnte, das frühere KZ zu betreten.
Und nun: Dora-Mittelbau. Wer sieht, wie der alte Mann ungeduldig gestikulierend vor dem Lageplan des Lagers steht, der weiß, dass nichts vergessen ist. Aufgeregt erklärt er seiner Begleiterin Ina Pawlowna Charlamowa, Vorsitzende der »Assoziation minderjähriger Häftlinge faschistischer Lager« im Moskauer Gebiet, wo die Zäune des später abgerissenen Lagers verliefen, Die Erinnerungen sind eingebrannt ins Gedächtnis: an den Zug, der an einem kalten Wintertag aus dem KZ Groß Rosen kam, mit Frauen, die auf der Fahrt alle erfroren waren und deren Leichen am Rand des Appell-Platzes gestapelt wurden; an Häftlinge, die nach Fluchtversuchen mit Hunden durch die Felder gejagt und schließlich von Bewohnern der Nachbardörfer ausgeliefert wurden; an Mitgefangene, die wegen eines im Stollen entwendeten Stücks Kabel erhängt wurden.
Manches freilich erfährt er erst jetzt, als er in der Bibliothek des modernen Gebäudes oberhalb des Appell-Platzes sitzt. Dort wurde im Jahr 2006 eine neue Dauerausstellung eröffnet, die von 8000 Menschen im Jahr besucht wird und preisgekrönt ist. Was aus einem Mithäftling geworden sei, was aus einem Lagerältesten, will er wissen. Als die Zeit bereits zu drängen beginnt, hat er noch eine letzte Frage: Wurden die Verantwortlichen verurteilt? 1947 habe in Dachau ein Prozess mit zehn Angeklagten stattgefunden, sagt Regine Heubaum, stellvertretende Leiterin der Gedenkstätte. Einer von ihnen wurde zum Tode, die anderen zu Haftstrafen verurteilt. Nepotschatow nickt. Dann erhebt er sich mit einem entschlossenen Ruck. Nu, poidjom, sagt er: Gehen wir!
Ein Gläschen für die toten Kameraden
Später steht Jakow Nepotschatow wieder vor dem Stollen, in dem er und seine Begleiter Blumen zum Andenken an seine verstorbenen Kameraden niedergelegt und mit einem Gläschen Wodka angestoßen haben. Ein gefülltes Glas lässt er neben den Nelken in der Dunkelheit stehen. Die Tür ist wieder ins Schloss gefallen. Er scheint zufrieden mit dem, was er gesehen hat: Seine und die Geschichte seiner Kameraden wird wach gehalten. Weil ihn solche Erlebnisse mit dem Land seiner einstigen Peiniger ausgesöhnt haben, wirbt er inzwischen selbst für Versöhnung: Tags darauf spricht er in einem Dresdner Gymnasium vor Schülern. Und auch nach Dora-Mittelbau wird er, wenn es die Gesundheit erlaubt, zurückkehren. Ob sie ihn wieder einladen dürfe, hat Heubaum ihn gefragt, und Nepotschatow hat nicht gezögert: Ja, sagt er. Gern.
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.