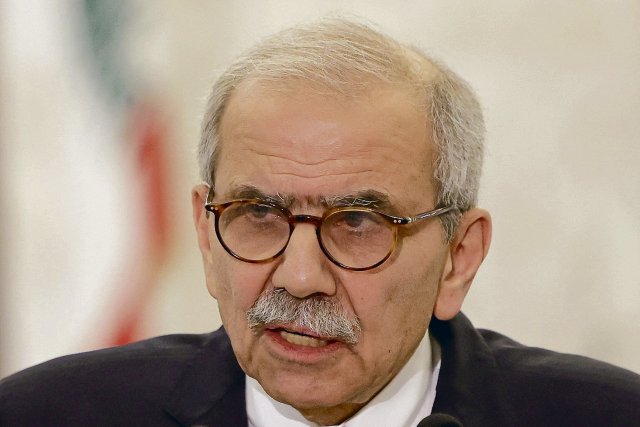Was macht Südamerikas rosarote Welle?
In Bolivien steht Morales vor einem Sieg, in Chile könnten Pinochets Erben an die Macht kommen
Linke Aufbruchstimmung gibt es in Uruguay: Ausgerechnet da, wo der strahlende Sieger José »Pepe« Mujica beteuert, dass er den gemäßigten Kurs des Sozialdemokraten Tabaré Vázquez fortsetzen will, und dabei der rechten Opposition die Hand zur Versöhnung ausstreckt. Mujica wolle in den kommenden fünf Jahren nur im Stil neue Akzente setzen, heißt es in der rechtsliberalen Presse Lateinamerikas fast beschwörend.
Damit dürfte sich Mujica nicht zufriedengeben. Seine »größte Verpflichtung« sieht er im Abbau der sozialen Ungleichheit, die seit 30 Jahren zunimmt. Dieses – im historischen Sinne – sozialdemokratische Ziel teilt er mit allen fortschrittlichen Staatsoberhäuptern des Subkontinents.
Viel mehr als der USA-freundliche Vázquez ist Mujica ein engagierter Verfechter der lateinamerikanischen Integration. »Wenn wir uns nicht zusammenschließen, sind wir in der Welt, die auf uns zukommt, zu einer neokolonialen Rolle verdammt«, warnt er. Die »nationalen Chauvinismen« zu überwinden, sei primär ein politisches Problem. Dass der Mercosur nach zwei Jahrzehnten nicht einmal als Zollunion reibungslos funktioniert, ist für Mujica ein Warnsignal.
Weitaus bedrohlicher für die »rosarote Welle« in Lateinamerika ist jedoch die Entwicklung in Honduras, aber auch im Andenraum. In der Praxis hat sich die Regierung Obama auf die Seite der Putschisten geschlagen. Nun soll der Staatsstreich vom Juni durch die Wahlfarce vom Sonntag legitimiert werden. Lateinamerikas Linksregierungen, allen voran Brasilien, wehren sich dagegen, doch ihr Einfluss in Zentralamerika bleibt begrenzt.
Auch das Ende Oktober unterzeichnete Militärabkommen zwischen den USA und Kolumbien ist eine Provokation für das sich emanzipierende Lateinamerika. Die Erlaubnis, die Luftwaffenbasis Palanquero zu nutzen, sei eine »einzigartige Möglichkeit, Operationen in einer ›kritischen‹ Region« durchzuführen, deren »Sicherheit und Stabilität ständig durch Anti-US-Regierungen bedroht sind«, heißt es in einer Kongressvorlage des Pentagons. Nicht nur sieben Militärstützpunkte, sondern auch zivile Flughäfen in Kolumbien dürfen von USA-Truppen künftig genutzt werden.
Dass Venezuelas Präsident Hugo Chávez darauf mit aggressiver Rhetorik reagiert, ist verständlich, aber letztlich kontraproduktiv: Mit dem Verweis auf die »venezolanische Gefahr« punktet in Kolumbien Álvaro Uribe, der seine zweite Wiederwahl im Mai 2010 anstrebt. Geschickter agiert Ecuadors Linksregierung unter Rafael Correa, die soeben wieder diplomatische Beziehungen zu Bogotá aufgenommen hat.
In Chile hingegen, wo die populäre Amtsinhaberin Michelle Bachelet nicht wiedergewählt werden kann, steht ein Wechsel bevor. Nach 20 Jahren Concertación-Regierung, also der Koalition zwischen Christdemokraten und Sozialisten, kann sich die Rechte mit dem Multimillionär Sebastián Piñera reale Hoffnungen auf ein Comeback machen. Der Ausgang der Stichwahl im Januar wird auch vom Gegenkandidaten abhängen – und davon, wie geschlossen sich das Mitte-Links-Spektrum hinter ihn stellt. Er, das ist entweder der christdemokratische Expräsident Eduardo Frei oder der junge Marco Enríquez-Ominami, der der Concertación den Rücken kehrte.
In Bolivien stehen am kommenden Sonntag alle Zeichen auf Wiederwahl von Evo Morales und seinem Vize Álvaro García Linera. Es geht nicht mehr darum, ob sie im Amt bestätigt werden, sondern wie deutlich. Seine Partei, die Bewegung zum Sozialismus, strebt sogar eine Zweidrittelmehrheit im Parlament an – eine wichtige Voraussetzung, um die hehren Ziele der neuen Verfassung in konkrete Gesetze zu gießen.
Morales profitiert nicht nur von Spaltung und Konzeptionslosigkeit der Opposition, sondern auch von der guten Wirtschaftsbilanz, die eine Fortsetzung der zahlreichen Sozialprogramme ermöglicht: Mit 3,2 Prozent wies Bolivien im ersten Halbjahr 2009 das höchste Wachstum in ganz Amerika auf. »Unser Gesellschaftsprojekt, das sage ich mit intellektueller Redlichkeit, wird sicher einige Jahrzehnte lang dauern«, meinte Vizepräsident Álvaro García Linera dieser Tage.
Die gewichtigste Wahl für den Subkontinent findet im Oktober 2010 in Brasilien statt. Wer Luiz Inácio Lula da Silva beerben wird, ist völlig offen – der Wahlkampf beginnt erst in drei Monaten.
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.