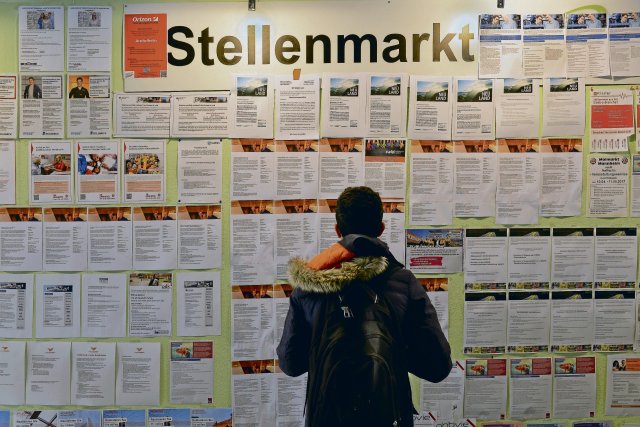Wahlsystem auf dem Prüfstand
Das Wahlsystem in Großbritannien ist vor dieser Wahl besonders unter Beschuss geraten. Denn auf den Inseln gilt das Mehrheitswahlrecht und nicht wie in Deutschland das personalisierte Verhältniswahlrecht. Das heißt: Gewählt ist der Kandidat, der die meisten Stimmen in seinem Wahlkreis erhält – ähnlich wie bei den Erststimmen in Deutschland. Die Stimmen der Gegner verfallen, egal wie viele sie gesammelt haben. Eine Zweitstimme für Parteilisten gibt es nicht.
Wer die Regierung bildet, hängt also davon ab, wer die meisten Wahlkreise gewonnen hat, und nicht davon, wer landesweit die meisten Stimmen erhielt. Viele finden das unfair, weil kleine Parteien durch das System benachteiligt werden. Kritik an dem System gibt es seit Jahrzehnten, reformiert wurde es jedoch nie.
Ein Beispiel: Hat Kandidat A 30 Prozent der Stimmen, Kandidat B auch 30 Prozent und Kandidat C 40 Prozent, dann zieht C ins Parlament – obwohl 60 Prozent der Wähler gegen ihn gestimmt haben. Die Stimmen für die anderen beiden Kandidaten werden nicht berücksichtigt. Das Wahlsystem führt quasi zu einem Zweiparteiensystem wie in den USA. Bisher waren fast immer die konservativen Tories oder die sozialdemokratische Labour-Partei an der Macht. Der Vorteil: Streit mit einem Koalitionspartner gibt es nicht, die Regierung ist stabil und handlungsfähig. Der Nachteil: Kleine und mittlere Parteien haben kaum Chancen, Wahlkreise und damit Sitze im Parlament zu gewinnen.
Das britische Mehrheitswahlrecht führt manchmal auch dazu, dass die Partei mit der landesweit höchsten Prozentzahl an Stimmen nicht unbedingt die meisten Sitze bekommt und also auch nicht die Regierung stellt. Im Gegenteil: Auch die Partei, die nach Wählerstimmen nur zweite oder dritte geworden ist, kann regieren. An die Regierung kommt, wer die absolute Mehrheit der Sitze im Parlament hat. Bei der Wahl sind 650 Sitze zu vergeben, mindestens 326 Sitze sind für die Regierungsmehrheit erforderlich.
Es kommt ein weiteres Manko hinzu: Tories und Liberaldemokraten müssen prozentual mehr Stimmen gewinnen als Labour, um an die Macht zu kommen. Das liegt am speziellen Zuschnitt der Wahlkreise und an Stammwählertraditionen. Traditionell gewinnen die Tories mehr Stimmen auf dem Land, Labour mehr in den Städten. (dpa/ND)
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.